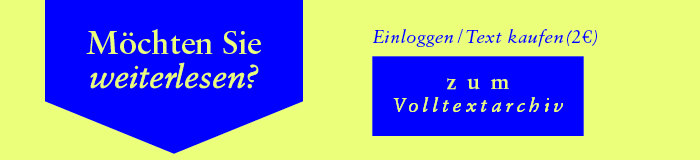„Die DDR hat’s nie gegeben“. Leerstellen in der aktuellen Erinnerungsdebatte
Im Frühjahr 2020 fand sich Achille Mbembe überraschend im Mittelpunkt einer explosiven Debatte wieder. Dem Kameruner Historiker und postkolonialen Vordenker, der für den Eröffnungsvortrag auf der Ruhrtriennale eingeladen war, wurde vorgeworfen, den Holocaust relativiert zu haben. In den deutschen Feuilletons nahm ein handfester Streit seinen Anfang, der sich weniger um Mbembe selbst und sein Werk drehte, als das Verhältnis von Holocaust-Erinnerung und postkolonialem Gedächtnis neu zu vermessen. Diese Auseinandersetzung, so zeigte zuletzt der Skandal um antisemitische Bilder bei der documenta fifteen, hält weiterhin an.
(Dieser Text ist im Septemberheft 2022, Merkur # 879, erschienen.)
Seit dem vergangenen Jahr entzündet sich eine Kontroverse bisher unbekannten Ausmaßes – von manchen bereits als »Historikerstreit 2.0« bezeichnet – an einer Polemik des australischen Genozidforschers A. Dirk Moses. Diese lief im Wesentlichen auf den Vorwurf hinaus, dass in Deutschland ein hegemoniales, quasireligiöses Gedenken an die Schoah vorherrsche, das eine adäquate Erinnerung an andere Massengewalt und Genozide und damit auch an die europäischen Kolonialverbrechen verhindere.1 In dem kurze Zeit später im Merkur ausgetragenen Disput zwischen dem Globalhistoriker Sebastian Conrad und dem Osteuropahistoriker Martin Schulze Wessel ging es, wenn auch unter anderen Vorzeichen, ebenfalls um die Frage nach der angemessenen Gewichtung von Kolonialismus und Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur.2
Nun ist der Impetus, hegemoniale Erinnerungsdiskurse und Herrschaftsnarrative zu hinterfragen, der sich in diesen Debatten Bahn bricht, natürlich grundsätzlich legitim. Problematisch erscheint uns allerdings die damit über die Parteiungen hinweg verbundene Zuversicht, die Komplexität, Diversität und Wandelbarkeit der Memorialkulturen hierzulande lasse sich über den eher schlichten Kollektivsingular der »deutschen Erinnerungskultur« analytisch angemessen fassen. Und das umso mehr, als der räumlich-singuläre Zuschnitt des Begriffs, der sich allein auf Westdeutschland bezieht, höchst selten hinterfragt wird. In so gut wie allen Beiträgen fallen die DDR und die neuen Bundesländer aus dem Blick heraus. »Die DDR hat’s nie gegeben.« So war es 2008 in kapitalen weißen Lettern an das Fundament des gerade abgerissenen Palasts der Republik geschrieben worden. Heute steht dort das Humboldt-Forum, dessen Fassade das Berliner Schloss nachbildet, einst Residenz der preußischen Könige und deutschen Kaiser.
Mit diesem geschichtspolitischen Einwurf ist es wie mit der Erinnerungskultur und eben auch dem aktuell geführten »Historikerstreit 2.0«: Dass es neben der westdeutschen auch eine ostdeutsche Erinnerung gegeben haben könnte, wird selten wahr-, noch seltener ernstgenommen. Neben der westdeutschen »Normalgeschichte« hat die DDR nur als überwundenes Interregnum Platz auf dem Trümmerhaufen der Geschichte. Dabei leben wir nicht nur in einer postnationalsozialistischen und postkolonialen Gesellschaft, sondern ebenso in einer postsozialistischen. Jenseits der vermeintlichen Dichotomie zwischen den Erinnerungen an die postkolonialen und postnationalsozialistischen Vergangenheiten existiert ein sozialistisches Erbe in Deutschland, das nicht nur unverbunden neben den beiden anderen Erinnerungskulturen steht, sondern die beiden Ersteren auch nachhaltig prägt. So ließe sich der Begriff der »Kotransformation« (Philipp Ther) auch auf die gebrochenen Erinnerungskulturen hierzulande anwenden.3
Conrad benennt die DDR immerhin als Mitfahrende im erinnerungspolitischen Karussell. Doch verlässt er – wie die meisten anderen – die bundesrepublikanische Plattform nicht, von der aus er sein Erinnerungsmodell aufbaut. Ohne jeden kritischen »Turn« kann er von einem erinnerungskulturellen »Transfer von West nach Ost« im Rahmen eines »Strukturanpassungsprogramms« sprechen.4 Diese Sichtweise kritisiert auch Schulze Wessel, weil die von Conrad postulierte »Angleichung der ostmitteleuropäischen Erinnerungskulturen an die deutschen und westeuropäischen Muster« so nicht stattgefunden habe. Schließlich entwickelte sich »neben der Holocaust-Erinnerung der Gulag« zu einem »Symbol der antitotalitären Erinnerung«, so Schulze Wessel – ohne die DDR auch nur mit einem Wort zu erwähnen. In seiner Antwort auf Schulze Wessels Replik reflektiert Conrad in Bezug auf die DDR immerhin, dass deren Erinnerungsgeschichte »angesichts der Verve der NS-versus-Kolonialismus-Diskussion aus dem Blick geraten« sei.5 Die westdeutsche Diskursreferenz aber bleibt bestehen.
(…)