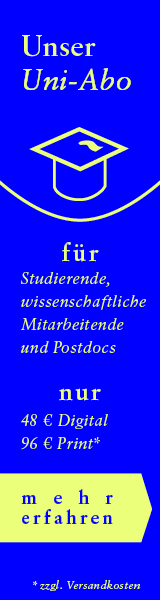Mai 23, 2016 - Keine Kommentare
Nachricht von Peter Praschl an Ekkehard Knörer: Sag Hanna, dass sie sich nicht über Wien lustig machen, sondern dass sie es verabscheuen soll. Kurzform einer Nachricht an Peter Praschl: Das will ich nicht. Nachricht von Peter Praschl: Du sollst es aber verachten, dieses Faschistennest. Der Austausch kommt zu einem guten Ende. Wir schicken Küsse von Berlin nach Wien und retour.
Während am 22. Mai die Wahllokale öffnen, schwimme ich das erste Mal in diesem Jahr draußen, im Jörgerbad. Der Freibadbereich ist nur so groß wie ein etwas überdimensionierter Privatgarten, mitten zwischen die Altbauten geklatscht. Aus den Fenstern kann man vermutlich selbst von hoch oben noch die kleinsten Dinge erkennen. Alles ist schön und voller Hoffnung an diesem Morgen, die Sonne und die Vögel und die warme Luft und meine Schulter, die nicht mehr weh tut und das Knie, das nicht mehr zieht, und man könnte auch noch was über die Körpermitte sagen. (mehr …)
Mai 09, 2016 - 1 Kommentar
Die Macht ist weder eine bloße Tatsache noch ein absolutes Recht. Sie zwingt nicht, sie überzeugt nicht. Sie nimmt für sich ein – was ihr leichter fällt, wenn sie sich auf die Freiheit beruft anstatt Angst und Schrecken einzuflößen.
Maurice Merleau-Ponty, „Notiz zu Machiavelli“ (1949)
Erstaunlich, wie selten Historiker mittlerweile der Wucht der über sie hereinbrechenden Geschichte ausgesetzt sind. Nach den Terroranschlägen, die im Januar 2015 Paris erschüttert haben, verspürte Patrick Boucheron – Historiker des Spätmittelalters, Autor in der Gegenwart und seit Dezember 2015 Inhaber eines Lehrstuhls für die „Geschichte der Machtformen in Westeuropa vom 13. bis 16. Jahrhundert“ am Collège de France – das Bedürfnis, diesem Zusammenstoß zwischen Wissenschaft und Lebenswelt gemeinsam mit dem Schriftsteller Mathieu Riboulet auf den Grund zu gehen. Schon im Titel verspricht Prendre dates eine Verabredung mit der Geschichte, auf die niemand gewartet hat. Diese Chronik der Woche vom 6. bis 14. Januar liefert keine Erklärungen, sondern stellt eher eine Versuchsanordnung dar. Es ist ein Dokument des Schocks, der Trauer, der Ausweglosigkeit – eine „Abraumhalde des konfusen Denkens“. Wer Intellektualität mit abgeklärter Distanz assoziiert, war von der aufgewühlten Intimität dieses Berichts überrascht. (mehr …)
Mai 04, 2016 - Keine Kommentare
Das neue Heft ist im Handel.
"Er hat die akademische Welt erschüttert", schrieb der Nouvel Obs. "Eine Lektion der Freiheit", lobte Les Inrocks. Als "meisterhaft" priesen einmütig Le Monde und Telerama die Antrittsvorlesung des Historikers Patrick Boucheron am Collège de France. Noch bevor sie Mitte Mai in Frankreich in Buchform erscheint, gibt es die Vorlesung zur Frage "Was die Geschichte vermag" als Aufmacher des Maihefts, sozusagen als Weltpremiere, in deutscher Übersetzung im Merkur.
Auch im zweiten Essay des Mai geht es um Geschichte: Der Schriftsteller und Historiker Per Leo unternimmt einen "Verkomplizierungsversuch" in Sachen Martin Heidegger, Schwarze Hefte und Nationalsozialismus - und erteilt den Philosophen dabei eine historische Lektion. (Der Text ist online frei lesbar.) Über Abhängigkeit denkt der Philosoph Andreas Dorschel nach, insbesondere darüber, wie sich die Abhängigkeit von Sachen zu der von Personen verhält.
In seiner Religionskolumne schildert Friedrich Wilhelm Graf, was bei den Vorbereitungen für das Luthergedenkjahr 2017 jetzt schon so alles durcheinander geht. Um Flucht- und Flüchtlingsbilder im Netz und im Kino, und um die Rede darüber, geht es in Simon Rothöhlers Filmkolumne. Till Breyer stellt in einem Rezensionsessay ein Buch von Jonathan Sheehan und Dror Wahrman vor, das das durch Adam Smith berühmt gewordene Konzept der "unsichtbaren Hand" in seinen ideenhistorischen Kontext stellt.
Auf drei Reisen zur Gegenwartskunst hat Robin Detje in Venedig, Istanbul und Berlin Kunst als Kommerz, Kunst mit politischem Anspruch, die brillante Theoretikerin Juliane Rebentisch und den sich in seine "man cave" zurückziehenden Philosophen Alexander Garcia Düttmann erlebt. (Das ist der zweite online frei zugängliche Text.) Jens Soentgen hat die Hoffnung aufgegeben, dass sich dieKlimaziele noch erreichen lassen - und plädiert für Umweltschutz im kleineren Maßstab. Sehr skeptisch sieht der Philosoph Reinhardt Brandt das ökumenische Projekt "The House of One". Eine Charakteristik des Sammelns und des Sammlers hat Christiaan L. Hart Nibbrig verfasst. Remigius Bunia schreibt über das ratsuchende Brüssel und Harry Walter über ein Foto voll "knisternder Erotik".
Zwei Worte noch zur Zusammensetzung des Hefts: Der jüngste Autor der Ausgabe ist 1984 geboren, der älteste 1937, die anderen liegen, gleichmäßig über die Geburtsjahrzehnte, dazwischen - das ergibt wie von selbst unterschiedliche Perspektiven. So wünschen wir uns das. Es ist in diesem Heft allerdings keine einzige Autorin vertreten: Das wünschen wir uns wiederum überhaupt nicht. Der Merkur lebt zu einem sehr großen Teil von den Texten, die uns unverlangt zugesandt werden. Es sind leider nach wie vor kaum Angebote von Autorinnen darunter. Natürlich bemühen wir uns auch in der Akquise. Mit, wie man sieht, manchmal sehr begrenztem oder ganz ausbleibendem Erfolg.
Die einzelnen Artikel und das ganze Heft in digitalen Formaten können Sie auf unserer Volltextarchivseite anlesen und kaufen, die Printausgabe gibt es versandkostenfrei hier. Eine schön handliche Übersicht über die Aboformen finden Sie wiederum hier.
Mai 02, 2016 - Keine Kommentare
Zum Prokrastinieren steht neben meinem Büro die Bibliothek des Forschungszentrums bereit, unter anderem lagern dort Stapel der New York Review of Books, darin las ich dieser Tage eine Rezension von Liz Garbus’ Film What happened Miss Simone, der wie die Rezension mit einem Ausschnitt aus einem Interview beginnt, das ein Reporter des öffentlichen Fernsehens New York 1968 mit Simone führte. Er fragt: „What’s ‚free’ to you?“ und sie antwortet unter anderem: „It’s just a feeling – it’s like how do you tell somebody how it feels to be in love – how do you tell anybody who’s not been in love what it’s like to be in love? You can not do it to save your life.“ Liebe ist eine Live-Veranstaltung, aber das gilt nicht umgekehrt, darum geht es hier. (mehr …)