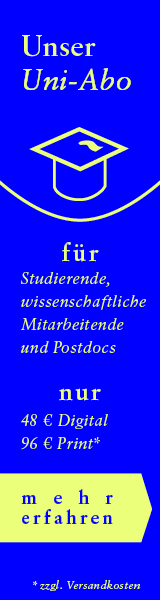Dezember 01, 2022 - Keine Kommentare
Jetzt nicht nachlassen. Auch die Startnummer sieben muss ordnungsgemäß anmoderiert werden. Dass es korrekt zugehen soll, macht Dieter Thomas Heck in dieser 1981er Folge der ZDF-Hitparade schon dadurch deutlich, dass er den zweiten Vornamen von Gottlieb Wendehals nennt: Viele wissen gar nicht, dass er Herbert lautet. Das kann ja auch leicht untergehen, denn schließlich, so zitiert Heck unmittelbar Wendehals, fliegen hier gleich die Löcher aus dem Käse. In einem Ausschnitt der Sendung, den »mdftrasher« auf YouTube eingestellt hat, kann man verfolgen, wie sich die Dinge weiter entwickeln. (mehr …)
November 01, 2022 - Keine Kommentare
Vor einer beliebten Bäckerei hatte sich eine Schlange gebildet, und einige von denen, die ihre Bestellung schon erhalten hatten, verzehrten sie direkt vor dem Ladenlokal stehend. Während auch ich anfing, ein noch warmes Gebäckstück direkt vor der Bäckerei zu essen, beobachtete ich eine Gruppe von drei Personen, vielleicht waren es auch vier, die im Kreis standen und auf den Boden schauten, dabei besprachen sie etwas, was ich akustisch nicht verstehen konnte. Ich sah, dass zu ihren Füßen eine Taube saß, die sich nicht mehr recht bewegen konnte, einer ihrer Flügel schien etwas abgeknickt zu sein. (mehr …)
Oktober 01, 2022 - Keine Kommentare
Sie wollten wissen, was richtig, richtig gut aussieht, also was der schönste Anblick auf der ganzen Welt ist. Mein Wissen teile ich sehr gern: die Krone einer sehr hoch gewachsenen, alten Kastanie, die nachts von unten von einer Straßenlaterne angeleuchtet wird. Das Blätterdach der Kastanie ist so dicht, dass Sie von unten eine Art grünen Teppich sehen, strukturiert durch die Blätter und deren Adern. Natürlich kann der Lampenschein nicht die gesamte Krone beleuchten, sondern immer nur einen Teil des dichten, grünen Laubwerks. Aber Sie können sogar im Dunkeln erahnen, wie viel mehr Grün da noch ist. So ein Baum hat ja mehr Blätter, als man schnell oder überhaupt zählen kann; jeder Baum ist ein Zeichen von Überfluss, mehr Grün, mehr, mehr, mehr! Am allerbesten sieht der Lichtkreis auf den Blättern aus, wenn die Kastanie gerade aufgekerzt hat und weiß blüht (rot ist auch okay, aber weiß ist am besten), am zweitbesten sieht es davor und danach aus. (mehr …)
September 01, 2022 - Keine Kommentare
Aus einer rechtswissenschaftlichen Dissertation aus dem Jahr 1913: »So wird z.B. regelmäßig der Tatbestand der versuchten Abtreibung nicht vorliegen, falls der verbrecherische Angriff sich gegen eine nur in der Vorstellung des Täters existierende Leibesfrucht richtet. Das gilt aber nicht ausnahmslos. Wie von Liszt den strafbaren Versuch der Abtreibung dann als gegeben erachtet, ›wenn das Vorhandensein einer Schwangerschaft nicht völlig ausgeschlossen erscheint‹, so kommen auch wir nach unseren obigen Deduktionen zum gleichen Resultat, indem wir das Tatsachenwissen des Täters und das Erfahrungswissen der Allgemeinheit unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Falles darüber entscheiden lassen, ob die Existenz resp. Tauglichkeit des Objektes gegeben war oder nicht. (mehr …)
Februar 14, 2020 - Keine Kommentare
Das folgende Gespräch besteht aus drei Akten. Nach einer Tagung über Tagungen im Jahr 2015, die unter anderem in vieler Hinsicht von dem Sozialverhalten handelte, das Menschen auf Tagungen zeigen, fingen wir an, über das nachzudenken, was intern zuerst "die Frauensache" hieß. Die Frauensache entwickelte sich zu einem fortgesetzten Gespräch über Misogynie, vor allem unsere eigene, und wie insbesondere die Nutzung von Twitter dazu führte, dass wir diese internalisierte Misogynie überhaupt als solche bemerkten. Für das Gespräch hilfreich waren viele Personen, die hier größtenteils mit Klarnamen vorkommen, außerdem Skype, Twitter, Telegram, die Audioaufnahmeapp von Kathrin Passigs Handy, unsere "Denkräume" und Getränke auf der Basis von fermentierter Horngurke. "Fermentierte Horngurke" zu schreiben ist peinlich genug. Die Blödheit in Bezug auf "die Frauensache" ist noch peinlicher. Weil man aber nur aus dokumentierter Blödheit etwas lernen kann, gibt es diesen Text. (mehr …)
Juni 18, 2019 - Keine Kommentare
Am vergangenen Samstag drängelten sich ungefähr 200 Leute bei drückender Hitze in einen fensterlosen und luftarmen Saal der Berliner Akademie der Künste am Hanseatenweg. Die Aufregung war groß, es war unklar, ob man reinkommen würde. Geboten wurde als Teil des Poesiefestivals Berlin ein Gespräch zwischen der Autorin und Übersetzerin Odile Kennel und Eileen Myles. Eine Stunde Poesiegespräch unter saunaartigen Luftverhältnissen nehmen sicher vor allem jene in Kauf, die Myles' Gedichte oder Bücher wie Chelsea Girls, Inferno oder Cool for you kennen. Diese Bücher sind mit „Prosa“ passend, weil an den Rändern fransig beschreiben, als long form poetry gehen sie auch durch. Vor allem aber stammen sie von einer Person, die Genre- und Genderkonventionen gleichermaßen durchbricht. (mehr …)
März 02, 2018 - 1 Kommentar
Zu Beginn des Wintersemesters 2016/2017 finde ich im Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt durch Zufall ein Buch. Literatur in Frankfurt. Ein Lexikon zum Lesen. Herausgegeben von Peter Hahn mit Fotos von Andreas Pohlmann, erschienen 1987 im athenäum Verlag, 692 Seiten. Von den 692 Seiten bestehen 600 aus Selbstvorstellungen von Autorinnen und Autoren, Büchermachern, Projektemacherinnen, Redakteurinnen usw. Neben den Portraits stehen jeweils eine kurze, selbstverfasste autobiographische Notiz und eine Auswahlbibliographie. Diese Literaturangabe regelt, wer dabei sein kann – im wesentlichen Leute über 30, das scheint auch damals schon die Grenze einer lexikonwerten bibliographischen Existenz zu sein. Aber oberhalb dieser Grenze sind alle dabei, 147 Personen sind „alle“. „Das Problem, wer als Autor zu gelten habe, wurde formal gelöst. Auch – weil es sich niemals anders lösen ließe.“ (S.11). Wer in Frankfurt schreibt (egal was), ist Autor. Auf die doppelseitige Selbstbeschreibung folgt stets ein zweiseitiger Text, Polemik, Lyrik, Essay oder Romanauszug: alles dabei. Nach den Portraits sind noch Aufsätze beigegeben, über die Frankfurter Verlagslandschaft, die Buchmesse, die Poetikvorlesung, den Adorno-Preis usw. Den Schluss des Buches bildet eine Sammlung von anonymen Zitaten von denjenigen, die nicht bereit waren, Teil des Buches zu werden, und ein Transkript eines Telefonats, das Peter Hahn mit Marcel Reich-Ranicki führte, dessen Abneigung gegen das Buch („das überflüssigste Buch“) ebenso groß war wie der Begehr, darin vertreten zu sein. (mehr …)
Dezember 04, 2017 - Keine Kommentare
Die Akte liegt digital vor. Farbig eingescannte, teils angegilbte Seiten, die Schatten, die das Papier dabei erzeugt hat, kehren am Bildschirm als Pixelwellen wieder. Zuerst rauscht es. Dann, auf Seite 34 erscheint das Gesuchte, Luhmann, und dann auch gleich im Rahmen eines Zeugnisses. Luhmann wird bezeugt, in dem Fall und der Akte so: „Herr Luhmann ist ein befähigter Jurist, ein schneller Denker und ein fleissiger Arbeiter. […] Dabei ist hervorzuheben, dass Herr Luhmann auch beim Vortrag umfangreicher Sachverhalte und in der Würdigung schwieriger Rechtsverhältnisse nicht am Konzept „klebt“. (mehr …)
Dezember 05, 2016 - Keine Kommentare
Peter Sloterdijk hat einen Roman geschrieben, ganz ohne Not, und auch nicht zum ersten Mal (siehe den Zauberbaum aus dem Jahr 1987, ein Auszug daraus war im übrigen sein letzter von zwei Auftritten im Merkur): Das Schelling-Projekt erzählt in E-Mail-Wechseln von einem (scheiternden) Projektantrag bei der DFG - es soll darum gehen, wie mit dem weiblichen Orgasmus der Geist in die Materie fuhr. Es ist im Roman allerdings so, dass sich für diese Frage vornehmlich forschende Männer (Peer Sloterdijk, Guido Mösenlechzner, Kurt Silbe) zuständig fühlen; ihre weiblichen Konterparts (Beatrice Freygel, Desiree zur Lippe) berichten beispielsweise von sexueller Erweckung mittels Gangbang. Für Eva Geulen und Hanna Engelmeier der Anlass, ihrerseits einen E-Mail-Wechsel zu beginnen, genau einen Monat lang, vom 8. Oktober bis zum 8. November, dem Tag der Trump-Wahl. Sloterdijks Roman war, wie sich zeigte, mehr Anlass für ein digressives Duett - einen schriftlichen Dialog darüber, welche Assoziationen zum Roman wie weit tragen. So geht es nun unter anderem um Autobiografien von (emeritierten) Professoren, um Machtpositionen im akademischen Betrieb, um Heinz Strunk, die Buchmesse und den Kritiker-Empfang des Suhrkamp Verlags bei der Frankfurter Buchmesse. Das Ganze war eine bei einer Zufallsbegegnung von Hanna Engelmeier und Eva Geulen spontan geborene Idee - da der Merkur (bzw. Ekkehard Knörer) dabei ebenfalls anwesend war, erscheint das Ergebnis nun hier, und zwar in drei Teilen. Dies ist der dritte Teil, den ersten Teil finden Sie hier, den zweiten hier. (mehr …)
Dezember 03, 2016 - Keine Kommentare
Peter Sloterdijk hat einen Roman geschrieben, ganz ohne Not, und auch nicht zum ersten Mal (siehe den Zauberbaum aus dem Jahr 1987, ein Auszug daraus war im übrigen sein letzter von zwei Auftritten im Merkur): Das Schelling-Projekt erzählt in E-Mail-Wechseln von einem (scheiternden) Projektantrag bei der DFG - es soll darum gehen, wie mit dem weiblichen Orgasmus der Geist in die Materie fuhr. Es ist im Roman allerdings so, dass sich für diese Frage vornehmlich forschende Männer (Peer Sloterdijk, Guido Mösenlechzner, Kurt Silbe) zuständig fühlen; ihre weiblichen Konterparts (Beatrice Freygel, Desiree zur Lippe) berichten beispielsweise von sexueller Erweckung mittels Gangbang. Für Eva Geulen und Hanna Engelmeier der Anlass, ihrerseits einen E-Mail-Wechsel zu beginnen, genau einen Monat lang, vom 8. Oktober bis zum 8. November, dem Tag der Trump-Wahl. Sloterdijks Roman war, wie sich zeigte, mehr Anlass für ein digressives Duett - einen schriftlichen Dialog darüber, welche Assoziationen zum Roman wie weit tragen. So geht es nun unter anderem um Autobiografien von (emeritierten) Professoren, um Machtpositionen im akademischen Betrieb, um Heinz Strunk, die Buchmesse und den Kritiker-Empfang des Suhrkamp Verlags bei der Frankfurter Buchmesse. Das Ganze war eine bei einer Zufallsbegegnung von Hanna Engelmeier und Eva Geulen spontan geborene Idee - da der Merkur (bzw. Ekkehard Knörer) dabei ebenfalls anwesend war, erscheint das Ergebnis nun hier, und zwar in drei Teilen. Den ersten Teil finden Sie hier, dies ist der zweite Teil. Der dritte ist hier.
(mehr …)