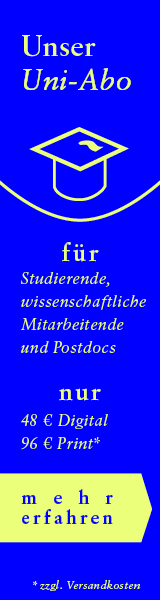Februar 28, 2013 - 4 Kommentare
Im Märzheft des Merkur unternimmt Ingo Meyer eine temporeiche Tour d'horizon der jüngeren ästhetischen Theorie (vor allem) im deutschen Sprachraum. Christian Demand hat nach der Lektüre des Textes einige Nachfragen. Die Kenntnis des Essays im Heft ist fürs Verständnis des Gesprächs nicht notwendig, wenngleich sie natürlich nicht schadet. Umgekehrt klärt das Gespräch sicher so manchen Punkt, der im Essay in beträchtlicher Verdichtung behandelt wird.
***
Christian Demand: Ihr Beitrag bietet eine furiose Abrechnung mit vier Jahrzehnten ästhetischer Theorie aller im deutschen Sprachraum relevanten Schulen und Positionen. Der Saldo fällt dabei, vorsichtig formuliert, nicht allzu positiv aus. Was genau stimmt Sie so skeptisch? Schließlich wird die Ästhetik im akademischen Betrieb gemeinhin als sichere Bank gehandelt – die Drittmittel fließen zügig, die Herausgeberbände füllen Regalmeter, kürzlich hat sogar das Max-Planck-Institut angekündigt, in Frankfurt am Main demnächst ein selbständiges Institut für empirische Ästhetik zu eröffnen. Es spricht also einiges dafür, dass das Geschäft brummt...
Ingo Meyer: Im Grunde ist Ästhetik ein undankbares Geschäft und Sie sitzen bald zwischen allen Stühlen. Man kann es eigentlich nur falsch machen. Empirie wird ja seit Fechners Zeiten immer wieder versucht, führt aber nicht sehr weit - und das will etwas heißen bei einer Disziplin, die einst von der sinnlichen Wahrnehmung ausging. Sie benötigen immer ziemlich weitreichende Vorannahmen, etwa diejenige, dass wir uns ästhetisch-geistig zur Welt verhalten können, Phantasie besitzen, was im Grunde ja erstaunlich ist. Damit landet man dann ruckzuck bei der Kulturanthropologie, die, soweit ich weiß, bei den Empirikern freilich Anathema ist. Die Empirie allein spricht nicht. Das ist aber lange bekannt.
Sie fragen nach meiner Skepsis, darf ich weiter ausholen? Wenn Sie Theorie bauen, müssen Sie entscheiden: deduktiv oder induktiv? Bieten Sie einen systematischen Grundriss an, wozu nach Adorno sehr viel Mut gehörte, heißt es, sehr schön, kann man aber nicht anwenden (und schon angewandter Adorno konnte schrecklich sein); liefern Sie nahrhafte Einzelstudien, bedankt sich die Fachdisziplin, aber Sie werden kaum eine Debatte anstoßen können. (mehr …)
Februar 28, 2013 - Keine Kommentare
Einen Teaser hatten wir ja bereits vorab veröffentlicht, Joachim Rohloffs eingehende Betrachtung von Frank Schirrmachers Payback-Bestsellerei. Aber auch der Rest des Hefts hat es in sich. So nimmt Ingo Meyer in seinem Ritt durch jüngere und jüngste Ästhetiktheorien kein Blatt vor den Mund und stellt fest: "Die gute alte Tante Ästhetik ist zwar sehr in die Breite, nicht aber in die Tiefe gegangen. Sie hätte heute mitzuarbeiten an einem theoretischen Rahmen, der die Komplexisierung unserer Weltbezüge ernsthaft ins Auge fasst, anstatt eifersüchtig über angestammte Hoheitsgebiete zu wachen." Als zweiter Text frei lesbar ist Helmut Königs "Lob der Dissidenz" - ein Rückblick auf den Widerstand gegen die kommunistischen Regime und seine Motive.
Außerdem: Merkur-Herausgeber Christian Demand und Redakteur Ekkehard Knörer präsentieren die Ergebnisse einer Reise ins Literaturarchiv in Marbach - Funde aus dem hoch bewegten Briefwechsel zwischen den Merkur-Gründungsherausgebern Hans Paeschke und Joachim Moras, die sich dabei als erstaunlich disharmonisches Doppel erweisen. Nach einer längeren Pause setzt Michael Rutschky die Veröffentlichung seiner Tagebücher - mit jeweils zwanzig Jahren Abstand - fort: In der neuesten Lieferung also mit Notizen aus dem Jahr 1993. Und dann noch eine Premiere, die manchen Blogleser freuen wird: Stephan Herczeg gibt es unter der Überschrift "Journal" jetzt regelmäßig auch im Print. Im Märzheft die erste Folge.
(Die komplette Übersicht mit Zitaten aus allen Artikeln plus Kauf- und Abomöglichkeit finden Sie hier.)
Februar 22, 2013 - Keine Kommentare
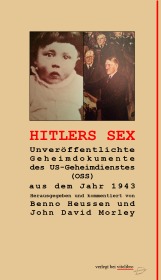 Gemeinsam mit dem britischen Schriftsteller John David Morley hat Merkur-Autor Benno Heussen in der von Vito von Eichborn betreuten E-Book-Edition Vitolibro den vielleicht etwas dröge betitelten Band Hitlers Sex veröffentlicht. (Hier DRM-frei für 2,99 Euro.) Darin versammelt sind neben einführenden und kommentierenden Texten der Herausgeber Auszüge aus dem Gutachten, das der Psychoanalytiker Walter C. Langer Ende des Jahres 1943 über The Mind of Adolf Hitler (so der Titel der Buchpublikation von 1972) erstellte. Erstmals veröffentlicht der Band jedoch - jedenfalls in der Zusammenstellung - die Resümees der Interviews, die die Grundlage für das Gutachten bildeten, unter anderen mit den ehemaligen Hitler-Weggefährten Otto Strasser (dem Bruder Gregor Strassers) und Ernst Hanfstaengl, der Richard-Wagner-Enkelin Friedelinde Wagner und dem bis 1935 im deutschen Film tätigen US-stämmigen Regisseur und Produzenten Alfred Zeisler. (Der hat übrigens 1944 in den USA einen Propagandafilm gegen Joseph Goebbels mit dem Titel Enemy of Women gedreht. Wer sucht, wird ihn auf Youtube finden.)
Benno Heussen berichtet, wie er an das Material gelangte: "Ich habe es dadurch entdeckt, dass mir im Rahmen einer rechtshistorischen Forschung über die NS-Zeit das Buch von Walter C Langer, das in Hamburg veröffentlicht worden war, in die Hände fiel. Dort fand ich den Vermerk, dass das Material, auf dem das Buch beruht, noch nicht (auch nicht in den USA) veröffentlicht worden ist. Dass es in der Kongressbibliothek in Washington liegt, war dort ebenfalls vermerkt. Ich bin dann anlässlich einer Dienstreise dort vorbeigegangen und wie das in den USA so üblich ist, kriegt man alles, was public domain ist, auf Mikrofiche geliefert."
Als Teaser für das Buch hier zwei Auszüge. Der erste ist die Prognose Langers für Hitlers Ende, 1943 erstellt und erstaunlich hellsichtig. Der zweite ist der Beginn einer Passage, in der Alfred Zeisler einen intimen Besuch der Schauspielerin Renate Müller (Viktor und Viktoria) bei Hitler schildert. (mehr …)
Gemeinsam mit dem britischen Schriftsteller John David Morley hat Merkur-Autor Benno Heussen in der von Vito von Eichborn betreuten E-Book-Edition Vitolibro den vielleicht etwas dröge betitelten Band Hitlers Sex veröffentlicht. (Hier DRM-frei für 2,99 Euro.) Darin versammelt sind neben einführenden und kommentierenden Texten der Herausgeber Auszüge aus dem Gutachten, das der Psychoanalytiker Walter C. Langer Ende des Jahres 1943 über The Mind of Adolf Hitler (so der Titel der Buchpublikation von 1972) erstellte. Erstmals veröffentlicht der Band jedoch - jedenfalls in der Zusammenstellung - die Resümees der Interviews, die die Grundlage für das Gutachten bildeten, unter anderen mit den ehemaligen Hitler-Weggefährten Otto Strasser (dem Bruder Gregor Strassers) und Ernst Hanfstaengl, der Richard-Wagner-Enkelin Friedelinde Wagner und dem bis 1935 im deutschen Film tätigen US-stämmigen Regisseur und Produzenten Alfred Zeisler. (Der hat übrigens 1944 in den USA einen Propagandafilm gegen Joseph Goebbels mit dem Titel Enemy of Women gedreht. Wer sucht, wird ihn auf Youtube finden.)
Benno Heussen berichtet, wie er an das Material gelangte: "Ich habe es dadurch entdeckt, dass mir im Rahmen einer rechtshistorischen Forschung über die NS-Zeit das Buch von Walter C Langer, das in Hamburg veröffentlicht worden war, in die Hände fiel. Dort fand ich den Vermerk, dass das Material, auf dem das Buch beruht, noch nicht (auch nicht in den USA) veröffentlicht worden ist. Dass es in der Kongressbibliothek in Washington liegt, war dort ebenfalls vermerkt. Ich bin dann anlässlich einer Dienstreise dort vorbeigegangen und wie das in den USA so üblich ist, kriegt man alles, was public domain ist, auf Mikrofiche geliefert."
Als Teaser für das Buch hier zwei Auszüge. Der erste ist die Prognose Langers für Hitlers Ende, 1943 erstellt und erstaunlich hellsichtig. Der zweite ist der Beginn einer Passage, in der Alfred Zeisler einen intimen Besuch der Schauspielerin Renate Müller (Viktor und Viktoria) bei Hitler schildert. (mehr …)
Februar 16, 2013 - 108 Kommentare
Vorbemerkung der Redaktion: Der folgende Text wird in der Printfassung im Märzheft des Merkur erscheinen. Wir machen ihn hier vorab zugänglich - und vor allem auch kommentierbar.
***
In diesen Tagen ist Frank Schirrmachers neuer Bestseller erschienen. Ego. Das Spiel des Lebens heißt er, und wovon auch immer er handeln mag, er wird monatelang auf der Liste des Spiegel stehen, in allen Zeitungen mit ernster Gebärde rezensiert werden, eine wichtige und längst überfällige Debatte anfachen oder lostreten, und Alexander Kluge wird sich seinen Inhalt in einem Selbstgespräch mit dem Autor zu eigen machen. Von diesem Buch kann hier nicht weiter die Rede sein; trotzdem soll Ihre Kaufentscheidung massiv und nachhaltig beeinflusst werden.
In Schirrmachers letztem Bestseller, Payback, ging es um den Computer und das Internet. Zwei Rezensenten fanden einen Fehler in der vierten Zeile der ersten Seite. »Tweeds« stand da, gemeint war aber »Tweets«. Wer eine Kurznachricht, die über den Internetdienst »Twitter« verbreitet wird, mit einem Anzugstoff verwechselt, gaben sie zu bedenken, werde den Nerds wenig zu sagen haben. Das ist wohl wahr. Wenn man trotzdem weiter liest, findet man sechs Zeilen später diese Worte: Würde ich morgen vom Internet oder Computer geschieden werden, wäre das nicht eine Trennung von dem Provider, sondern es wäre das Ende einer sozialen Beziehung, die (!) mich tief verstören würde. (13) So steht es im zweiten Absatz der ersten Seite der ersten Auflage, so steht es auch noch in der zweiten, in der dritten und in der vierten Auflage und im Taschenbuch. Und selbst als Schirrmacher in einem Tonstudio saß, um seinen Text für die Hörbuchausgabe vorzulesen, fiel ihm nichts auf. Ihm gegenüber saß ein Regisseur, dem auch nichts auffiel.
Und so geht es immer weiter, über 240 Seiten bis zu den Anmerkungen und dem Personenregister. Ständig muss der Leser schlauer sein als der Text, wenn er ihn verstehen will. Hier muss ein Komma, dort ein Wort eingefügt oder gestrichen werden, hier muss man den Numerus, dort das Tempus oder den Modus eines Verbs korrigieren, bis man meint, man habe es nicht mit dem Kulturkopf der FAZ zu tun, sondern mit einem Praktikanten von Kicker online. Viele Sätze muss man zwei- oder dreimal lesen, bevor man den Fehler entdeckt und beheben kann. Dann erst stellt ein Sinn sich ein, von dem man aber nie mit Gewissheit annehmen darf, er treffe das, was der Autor sagen wollte. Das Internet fresse unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit, behauptet Schirrmacher. Bei der Lektüre seines Buches denkt man eher, es sei die Verkommenheit der hiesigen Verlagsbranche. (mehr …)
Februar 08, 2013 - Keine Kommentare
Wir gratulieren unserem Literaturkolumnisten David Wagner zum Platz auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse. Seine nächste - und leider letzte - Kolumne erscheint im Herbst. Alle bisherigen lassen sich aber auch digital erwerben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Seine Erzählung Für neue Leben, eine Vorstufe des jetzt nominierten Romans Leben, ist ebenfalls im Merkur erschienen. Auch auf der Shortlist: Wolfgang Streeck, dessen Aufsatz Wissen als Macht, Macht als Wissen im letzten Merkur-Doppelheft zu lesen war.
Ebenfalls gratulieren wir Thomas Hettche - von ihm haben wir im Juni vergangenen Jahres den Essay Feindberührung veröffentlicht - zum nicht so attraktiv benamsten, aber attraktiv (mit 20.000 Euro) dotierten Düsseldorfer Literaturpreis der Stadtsparkasse. Er erhält ihn für seinen Essayband Totenberg, der auch den Merkur-Text enthält.
Februar 07, 2013 - 3 Kommentare
Der an der Universität Luzern lehrende Historiker Valentin Groebner ist für seine provokanten Überlegungen und pointierten Formulierungen bekannt; zuletzt konnte er seine Fähigkeiten bei der in München abgehaltenen Tagung Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: Wie kommunizieren Geisteswissenschaftler in der digitalen Zukunft ausspielen, wo er vor versammeltem, zumeist netzaffinem Publikum, das gekommen war, das zweijährige Bestehen der geschichtswissenschaftlichen Rezensionsplattform recensio.net zu feiern, ein Plädoyer für Papiermedien und die "Netzunabhängigkeit" der Wissenschaft hielt. (mehr …)
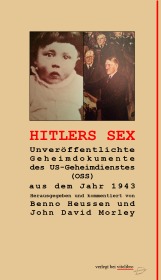 Gemeinsam mit dem britischen Schriftsteller John David Morley hat Merkur-Autor Benno Heussen in der von Vito von Eichborn betreuten E-Book-Edition Vitolibro den vielleicht etwas dröge betitelten Band Hitlers Sex veröffentlicht. (Hier DRM-frei für 2,99 Euro.) Darin versammelt sind neben einführenden und kommentierenden Texten der Herausgeber Auszüge aus dem Gutachten, das der Psychoanalytiker Walter C. Langer Ende des Jahres 1943 über The Mind of Adolf Hitler (so der Titel der Buchpublikation von 1972) erstellte. Erstmals veröffentlicht der Band jedoch - jedenfalls in der Zusammenstellung - die Resümees der Interviews, die die Grundlage für das Gutachten bildeten, unter anderen mit den ehemaligen Hitler-Weggefährten Otto Strasser (dem Bruder Gregor Strassers) und Ernst Hanfstaengl, der Richard-Wagner-Enkelin Friedelinde Wagner und dem bis 1935 im deutschen Film tätigen US-stämmigen Regisseur und Produzenten Alfred Zeisler. (Der hat übrigens 1944 in den USA einen Propagandafilm gegen Joseph Goebbels mit dem Titel Enemy of Women gedreht. Wer sucht, wird ihn auf Youtube finden.)
Benno Heussen berichtet, wie er an das Material gelangte: "Ich habe es dadurch entdeckt, dass mir im Rahmen einer rechtshistorischen Forschung über die NS-Zeit das Buch von Walter C Langer, das in Hamburg veröffentlicht worden war, in die Hände fiel. Dort fand ich den Vermerk, dass das Material, auf dem das Buch beruht, noch nicht (auch nicht in den USA) veröffentlicht worden ist. Dass es in der Kongressbibliothek in Washington liegt, war dort ebenfalls vermerkt. Ich bin dann anlässlich einer Dienstreise dort vorbeigegangen und wie das in den USA so üblich ist, kriegt man alles, was public domain ist, auf Mikrofiche geliefert."
Als Teaser für das Buch hier zwei Auszüge. Der erste ist die Prognose Langers für Hitlers Ende, 1943 erstellt und erstaunlich hellsichtig. Der zweite ist der Beginn einer Passage, in der Alfred Zeisler einen intimen Besuch der Schauspielerin Renate Müller (Viktor und Viktoria) bei Hitler schildert. (mehr …)
Gemeinsam mit dem britischen Schriftsteller John David Morley hat Merkur-Autor Benno Heussen in der von Vito von Eichborn betreuten E-Book-Edition Vitolibro den vielleicht etwas dröge betitelten Band Hitlers Sex veröffentlicht. (Hier DRM-frei für 2,99 Euro.) Darin versammelt sind neben einführenden und kommentierenden Texten der Herausgeber Auszüge aus dem Gutachten, das der Psychoanalytiker Walter C. Langer Ende des Jahres 1943 über The Mind of Adolf Hitler (so der Titel der Buchpublikation von 1972) erstellte. Erstmals veröffentlicht der Band jedoch - jedenfalls in der Zusammenstellung - die Resümees der Interviews, die die Grundlage für das Gutachten bildeten, unter anderen mit den ehemaligen Hitler-Weggefährten Otto Strasser (dem Bruder Gregor Strassers) und Ernst Hanfstaengl, der Richard-Wagner-Enkelin Friedelinde Wagner und dem bis 1935 im deutschen Film tätigen US-stämmigen Regisseur und Produzenten Alfred Zeisler. (Der hat übrigens 1944 in den USA einen Propagandafilm gegen Joseph Goebbels mit dem Titel Enemy of Women gedreht. Wer sucht, wird ihn auf Youtube finden.)
Benno Heussen berichtet, wie er an das Material gelangte: "Ich habe es dadurch entdeckt, dass mir im Rahmen einer rechtshistorischen Forschung über die NS-Zeit das Buch von Walter C Langer, das in Hamburg veröffentlicht worden war, in die Hände fiel. Dort fand ich den Vermerk, dass das Material, auf dem das Buch beruht, noch nicht (auch nicht in den USA) veröffentlicht worden ist. Dass es in der Kongressbibliothek in Washington liegt, war dort ebenfalls vermerkt. Ich bin dann anlässlich einer Dienstreise dort vorbeigegangen und wie das in den USA so üblich ist, kriegt man alles, was public domain ist, auf Mikrofiche geliefert."
Als Teaser für das Buch hier zwei Auszüge. Der erste ist die Prognose Langers für Hitlers Ende, 1943 erstellt und erstaunlich hellsichtig. Der zweite ist der Beginn einer Passage, in der Alfred Zeisler einen intimen Besuch der Schauspielerin Renate Müller (Viktor und Viktoria) bei Hitler schildert. (mehr …)