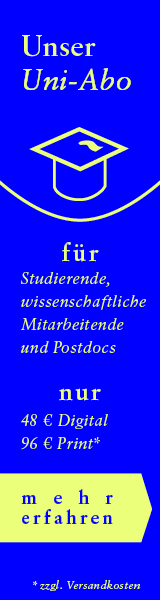-
Januar 26, 2015 - 6 Kommentare
Agathe Novak-Lechevalier ist maître de conférences (in etwa: Assistenzprofessorin) an der Université Paris X Nanterre. Sie ist Chefredakteurin des Magasin du XIXe sciècle, ihre Interessen umfassen dabei Roman und Spektakel, außerdem beforscht sie Stendhal und Balzac. Aus diesem sauber kuratierten Portfolio fallen ihre Arbeiten zu Michel Houellebecq etwas heraus.
Dieser Forscherpersönlichkeit dankt der Autor am Ende seines neuesten Romans Unterwerfung, der im Jahr 2022 spielt und von den Problemen eines abgehalfterten Literaturwissenschaftlers in einem Frankreich unter islamischer Regierung handelt. Direkt am Erscheinungstag wurde Unterwerfung (deutsch für: Islam) auf eine Art notorisch, die zu wiederholen hier überflüssig ist. Von dem Terror-Anschlag auf Charlie Hebdo ist Houellebecq nicht nur persönlich hart getroffen worden, sondern er durchkreuzt auch das Anliegen seines Romans. Worin dieses besteht, wird in dem kurzen Paratext auf der letzten Seite deutlich. Hier liegt gewissermaßen das punctum des ganzen Buches, die Danksagung legt offen, was die Bedingung der Möglichkeit dieses Romans ist: nämlich dass das, was er beschreibt, eine unrealisierte Fiktion bleibt. Damit ist viel weniger eine wie auch immer geartete Islamisierung gemeint, sondern ein ästhetisches Programm. Davon sprechen wir hier.
In Unterwerfung werden Frauen aus dem akademischen Leben herausgeschrieben. Mit Agathe Novak-Lechevalier wird aber nun eine Frau angeblich als einzige Quelle für alle Informationen zuständig, die Houellebecq für seine Schilderung des akademischen Lebens braucht. Es ist nicht so wichtig, ob das stimmt oder nicht: Deutlich wird, dass hier von einer Literatur die Rede ist, die allein auf Hörensagen beruhen darf, die sich aus abgefrühstückten Ideen und Phrasen zusammensetzen darf, wenn sie nur einen bestimmten Zweck erfüllt. Und der besteht hier primär in der Besetzung einer literaturhistorischen Position und nur sekundär in Houellebecqs lange bekannter Opposition gegen den Islam. (mehr …) -
Januar 20, 2015 - 4 Kommentare
"Es wird ohnehin längst aus allen Rohren geschossen. Unter merkur-blog.de findet sich eine Chronik der laufenden Ereignisse rund um das Heft." Schreibt Gregor Dotzauer im Tagesspiegel (vom 18. Januar, nicht jetzt online), in dem er unter der Überschrift "Der Himmel über der Bleiwüste" über unseren Relaunch berichtet. Recht hat er, und Selbstreferenzialität können wir auch. Ansonsten stellt Dotzauer fest: "Dennoch ist der Relaunch eher eine Retusche. Man hat ... nicht den Eindruck, eine andere Zeitschrift in der Hand zu halten, wohl aber eine deutlich besser lesbare." Skeptischer ist er, ob das mit der im neuen Erklärtext geforderten "Distanz zum Feuilleton wie zu Fachzeitschriften" gelingen kann, beziehungsweise ob es auch "zurück in eine Debattenkultur führt, die unter den agents provocateurs Bohrer und Scheel auch der bundesrepublikanischen Medienökologie vor der Netzdämmerung geschuldet war". Wenn er hinzufügt, dass selbst die Redaktion das bezweifelt, hat er sicherlich recht. Die Frage ist allerdings auch, ob die Redaktion von dergleichen überhaupt träumt.
Gustav Seibt hält in der Süddeutschen (vom 14. Januar, leider auch nicht online) in Sachen Layoutreform fest: "Am wichtigsten für den Leser ist der etwas lichtere, freundlichere Satz der Texte. Die Anmutung ist insgesamt weniger bleiern." Eigentlich - und da sind wir natürlich völlig d'accord - komme es aber auf etwas anderes an: "Entscheidend ist, dass sich am Anspruch der Zeitschrift nichts geändert hat." Und damit zum Schwerpunkt "Die Gegenwart des Digitalen": "Die sechs damit befassten Texte wechseln sich in gründlicher Information und spekulativer Erörterung ab, und wer sich ohne medienphilosophisches Tamtam auf den Stand der Dinge bringen möchte, wird ausgezeichnet versorgt." Wenn das also die Alternative wäre - "Stand der Dinge ohne medienphilosophisches Tamtam" versus "zurück zur Debattenkultur vor der Netzdämmerung" - dann hat die Redaktion eine entschiedene Präferenz.
Auch die FR bzw. Berliner Zeitung hat berichtet, Autor ist Harry Nutt. In Sachen Layout wertet er nicht, hebt inhaltlich als "den interessantesten Beitrag" den von Dirk Baecker heraus, der bei Seibt als "spekulativster, darum auch anfechtbarster" Text des Januarhefts figuriert. In Bezug auf die im Essay von Carlos Spoerhase und Caspar Hirschi genannten Summen, die man für akademische Zeitschriften heute oft hinblättern muss, meint Seibt im übrigen: "Wer die dort üblichen fünfstelligen Summen wahrnimmt, kann die 120 Euro für ein Jahresabonnement des Merkur schwerlich übertrieben finden." Stimmt natürlich. Und für Studierende sind es ja jetzt schon nur 80. (Mehr dazu hier.) Darüber hinaus werden wir ab März aber den nicht so begüterten potenziellen LeserInnen ein Angebot unterbreiten, das man nicht so einfach ablehnen kann. Dazu dann zu gegebener Zeit aber mehr. shemales schweiz
P.S.: Hier Christian Demands Gespräch im Deutschlandradio zum aktuellen Heft.
-
Januar 12, 2015 - 2 Kommentare
Man kennt Hélène Cixous in der Brasserie Zeyer, und sie wird unter freundlichem Fragen nach dem werten Befinden an ihren Platz geführt. Noch ist das messinghelle Lokal fast leer, es wird sich im Laufe unseres Essens mit lebhaften Gästen füllen, die sich vor allem den Früchten der Austernsaison widmen. Auch wir beginnen mit einer Platte Fines de Claires verschiedener Größe, deren Herkunft und Qualitäten der maître d’hotel erklärt. Letztes Jahr, anlässlich des hundertsten Geburtstags des Restaurants, habe es ein Austernfest gegeben, bei dem die Züchter aus der Normandie ihre Austern vorgestellt hätten. „Hundert Jahre seid ihr alt!“, sagt Hélène, und der maître nickt stolz. Als er gegangen ist, sagt sie: "Drei Jahre jünger als Eve."
Eve war Hélènes Mutter. Letztes Jahr ist sie im Alter von 103 Jahren gestorben. Ihren Hundertsten feierten die beiden noch mit einem Spaziergang und einem Kaffee auf der Terrasse des Pavillon Montsouris; die Fotos zeigen die alte Dame, gebeugt und fragil, mit ihrem verhaltenen Lächeln und einer kessen Ballonmütze. Da wohnte Eve noch in ihrer kleinen Wohnung unweit des Parks und versorgte sich selbst. Wenig später aber wollte oder konnte sie nicht mehr aufstehen, und wurde in Hélènes Wohnung, am Ende mit Hilfe zweier Pfleger, in den Tod begleitet. Der lange Weg des Verfalls, des zwischenzeitlichen Auflebens, des Ringens um Sprache und Orientierung und des endlichen Verdämmerns ist von Cixous in Homère est morte (Paris: éditions galilée 2014) in schwer zu lesender Intensität dargestellt worden. (mehr …) -
Januar 06, 2015 - 1 Kommentar
 Das Januarheft ist da. Es ist ein besonderes Heft. Nach 23 Jahren erscheint der Merkur im neuen Layout - und geht damit auch zurück ins alte, etwas kleinere Format. Wir bleiben, was den Relaunch betrifft, ganz ordentlich im Rhythmus, das vorletzte Redesign liegt 24 weitere Jahre zurück, es war zum Januar 1968 erfolgt: 1947 - 1968 - 1992 - 2015. Die Veränderungen sind nicht dramatisch, aber sie greifen in jedes Detail durch. Auf dem Titel sind die quer verstrebenden Linien gestrichen, das sieht nun offener aus. Dafür nehmen zwei Streifen oben und unten die Signaturfarbe rot auf; im Inneren setzen sich die Streifen in grau am oberen Rand (im Kritikteil) und in der Innenfalz (in den Marginalien) fort, als Schmuck und Orientierung.
Das Umschlagpapier sagt "Papier" und ist nicht mehr lackiert. Die Brotschrift (Sabon) ist großzügiger, auf den Seiten ist mehr Luft, viel weniger Text ist dennoch nicht im jetzt meist etwas umfangreicheren Heft. Auf Nachfrage gerne mehr zu weiteren Einzelheiten. Kommentare, Kritik, Rückfragen sind selbstverständlich erwünscht. Wir haben von der Januarausgabe zusätzliche Hefte drucken lassen und verschicken natürlich Rezensionsexemplare.
Das Heft hat einen inhaltlichen Schwerpunkt zur "Gegenwart des Digitalen". Sechs Text, über alle drei Rubriken verteilt, befassen sich mit Fragen der Digitalität. Den größten Rahmen zieht Dirk Baecker mit seinem Vorschlag, Information als Leitbegriff der nächsten Gesellschaft zu verstehen. Ted Striphas geht dem Zusammenhang von Sprache und Internet nach. Günter Hack kann zeigen, dass das Internet nicht einfach, wie oft behauptet, eine Erfindung aus dem Geist des Militärs ist. Von den Umbrüchen in den geisteswissenschaftlichen Verlagen berichten Caspar Hirschi und Carlos Spoerhase. Valentin Groebner ist von Peter Burkes Buch über "Die Explosion des Wissens" bitter enttäuscht.
Mehr als erwähnenswert: Nach dreißig Jahren erscheint erstmals wieder ein Text von Alexander Kluge im Merkur - Politische Geologie besteht aus erzählerischen Skizzen, die um das Kriegsende 1945 kreisen. Eva Geulen denkt über Unübersetzbares und Begriffsgeschichte nach. In den Kolumnen geht es um Gedenkstätten und ihre Sichtbarkeit (Christian Demand) und die Zukunft des Pop im Zeichen von Retromanien (Eckhard Schumacher). Außerdem: Ljudmila Belkin über die Vielheit des Donbass. Frei lesbar sind, wie schon vermeldet, Günter Hacks Essay sowie ein Text von Paul Kahl und Hendrik Kalvelage über die Nazi-Verstrickungen des Goethe-Nationalmuseums in Weimar.
Inhaltsverzeichnis / Kaufoptionen
Das Januarheft ist da. Es ist ein besonderes Heft. Nach 23 Jahren erscheint der Merkur im neuen Layout - und geht damit auch zurück ins alte, etwas kleinere Format. Wir bleiben, was den Relaunch betrifft, ganz ordentlich im Rhythmus, das vorletzte Redesign liegt 24 weitere Jahre zurück, es war zum Januar 1968 erfolgt: 1947 - 1968 - 1992 - 2015. Die Veränderungen sind nicht dramatisch, aber sie greifen in jedes Detail durch. Auf dem Titel sind die quer verstrebenden Linien gestrichen, das sieht nun offener aus. Dafür nehmen zwei Streifen oben und unten die Signaturfarbe rot auf; im Inneren setzen sich die Streifen in grau am oberen Rand (im Kritikteil) und in der Innenfalz (in den Marginalien) fort, als Schmuck und Orientierung.
Das Umschlagpapier sagt "Papier" und ist nicht mehr lackiert. Die Brotschrift (Sabon) ist großzügiger, auf den Seiten ist mehr Luft, viel weniger Text ist dennoch nicht im jetzt meist etwas umfangreicheren Heft. Auf Nachfrage gerne mehr zu weiteren Einzelheiten. Kommentare, Kritik, Rückfragen sind selbstverständlich erwünscht. Wir haben von der Januarausgabe zusätzliche Hefte drucken lassen und verschicken natürlich Rezensionsexemplare.
Das Heft hat einen inhaltlichen Schwerpunkt zur "Gegenwart des Digitalen". Sechs Text, über alle drei Rubriken verteilt, befassen sich mit Fragen der Digitalität. Den größten Rahmen zieht Dirk Baecker mit seinem Vorschlag, Information als Leitbegriff der nächsten Gesellschaft zu verstehen. Ted Striphas geht dem Zusammenhang von Sprache und Internet nach. Günter Hack kann zeigen, dass das Internet nicht einfach, wie oft behauptet, eine Erfindung aus dem Geist des Militärs ist. Von den Umbrüchen in den geisteswissenschaftlichen Verlagen berichten Caspar Hirschi und Carlos Spoerhase. Valentin Groebner ist von Peter Burkes Buch über "Die Explosion des Wissens" bitter enttäuscht.
Mehr als erwähnenswert: Nach dreißig Jahren erscheint erstmals wieder ein Text von Alexander Kluge im Merkur - Politische Geologie besteht aus erzählerischen Skizzen, die um das Kriegsende 1945 kreisen. Eva Geulen denkt über Unübersetzbares und Begriffsgeschichte nach. In den Kolumnen geht es um Gedenkstätten und ihre Sichtbarkeit (Christian Demand) und die Zukunft des Pop im Zeichen von Retromanien (Eckhard Schumacher). Außerdem: Ljudmila Belkin über die Vielheit des Donbass. Frei lesbar sind, wie schon vermeldet, Günter Hacks Essay sowie ein Text von Paul Kahl und Hendrik Kalvelage über die Nazi-Verstrickungen des Goethe-Nationalmuseums in Weimar.
Inhaltsverzeichnis / Kaufoptionen -
Januar 03, 2015 - 1 Kommentar
Zum Tod von Ulrich Beck schalten wir seinen Text Der anthropologische Schock. Tschernobyl und die Konturen der Risikogesellschaft bis Mitte des Monats frei. Es ist einer von drei Texten Becks im Merkur (veröffentlicht in Heft 450, August 1986, also zeitgleich mit dem Erscheinen des Klassikers Die Risikogesellschaft). Der erste von Becks Merkur-Texten, Jenseits von Stand und Klasse Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft, wurde im Mai 1984 (hier als kostenpflichtiges pdf), der letzte, Die Selbstwiderlegung der Bürokratie Über Gefahrenverwaltung und Verwaltungsgefährdung, im August 1988 (hier als kostenpflichtiges pdf) veröffentlicht.
I
Die Ausnahme bringt die lange verdrängte Regel zu Bewußtsein: den Alltag im Atomzeitalter. Woran unsere Lebensformen einen historischen Augenblick lang zerschellt sind, soll hier von drei Seiten beleuchtet werden: die Enteignung der Sinne; die Weltendifferenz zwischen Sicherheit und wahrscheinlicher Sicherheit; und die absolute, alle Grenzen und Schutzzonen aufhebende Zugewiesenheit der Gefahr.
Was wäre geschehen, wenn die Wetterdienste versagt, die Massenmedien geschwiegen, die Experten sich nicht gestritten hätten? Niemand von uns hätte etwas bemerkt. Wir sehen, hören weiter, aber die Normalität unserer sinnlichen Wahrnehmung täuscht: Vor dieser Gefahr versagen unsere Sinne. Wir, alle, eine ganze Kultur sind auf einen Schlag erblindet im Sehen (taub geworden im Hören usw.). Was beides meint: die Unfaßlichkeit einer für unsere Sinne unveränderten Welt und die hinter den Dingen steckende, unserem Blick, unserer ganzen Aufmerksamkeit verschlossene Verseuchung und Gefahr. Mit dem Atomzeitalter entsteht eine Verdoppelung der Welt. Die Welt hinter der Welt, die uns unvorstellbar bedroht, bleibt unseren Sinnen ein für allemal unzugänglich. Dies gilt auch dann, wenn der Grad der Verseuchung "ungefährlich ist. Die Universalität der Bedrohung und die pauschale Entwertung der Sinne in der Gefahr geben der Debatte um Grad und Gefährlichkeit der Verseuchung, die nun öffentlich tobt und sich noch ganz in die Magie physikalischer Formeln verirrt hat, erst ihren tiefen kulturellen Hintersinn und ihre soziale Brisanz.
Tschernobyl hat von einem Tag auf den anderen bewußt werden lassen, was schon längst gilt: Nicht nur im Atomzeitalter, auch im Umgang mit chemischen Giften in Luft, Wasser, Nahrungsmitteln usw. haben sich die Besitzverhältnisse im Zugriff auf Wirklichkeit grundlegend verändert. In einer berühmten Analogie gesprochen: Die private Verfügung über die Wahrnehmungsmittel ist aufgehoben. Med. dr. Eugenijus Mockaitis apie nevaisingumo priežastis ir gydymą, kepenų valymą, meilę, g tašką, aromaterapiją, Ajurvedą, osteochondrozę, sveiką gyvenseną, maistą ir dietas. Die Sinne sind - in der vollen Pracht ihrer Wirklichkeitsbilder - enteignet worden. Uns geht es nicht anders als den Salatköpfen, warum auch: Ebenso wie der Salat (grün, frisch und knackig wie immer), der verseucht ist oder als verseucht gilt (dieser Unterschied wird unerheblich), in den Händen seines Besitzers ökonomisch und sozial verdorrt ist, ebenso sind unsere Sinne im Angesicht der atomaren Gefahr nutz- und funktionslos geworden. Worüber wir uns durch ihre volle Funktionstüchtigkeit nur zu leicht und gerne hinwegtäuschen lassen.
...
Die Freischaltung des Textes war, wie angekündigt, befristet. Für 2 Euro lässt sich der komplette Text als pdf jederzeit im Volltext-Archiv abrufen.
 Das Januarheft ist da. Es ist ein besonderes Heft. Nach 23 Jahren erscheint der Merkur im neuen Layout - und geht damit auch zurück ins alte, etwas kleinere Format. Wir bleiben, was den Relaunch betrifft, ganz ordentlich im Rhythmus, das vorletzte Redesign liegt 24 weitere Jahre zurück, es war zum Januar 1968 erfolgt: 1947 - 1968 - 1992 - 2015. Die Veränderungen sind nicht dramatisch, aber sie greifen in jedes Detail durch. Auf dem Titel sind die quer verstrebenden Linien gestrichen, das sieht nun offener aus. Dafür nehmen zwei Streifen oben und unten die Signaturfarbe rot auf; im Inneren setzen sich die Streifen in grau am oberen Rand (im Kritikteil) und in der Innenfalz (in den Marginalien) fort, als Schmuck und Orientierung.
Das Umschlagpapier sagt "Papier" und ist nicht mehr lackiert. Die Brotschrift (Sabon) ist großzügiger, auf den Seiten ist mehr Luft, viel weniger Text ist dennoch nicht im jetzt meist etwas umfangreicheren Heft. Auf Nachfrage gerne mehr zu weiteren Einzelheiten. Kommentare, Kritik, Rückfragen sind selbstverständlich erwünscht. Wir haben von der Januarausgabe zusätzliche Hefte drucken lassen und verschicken natürlich Rezensionsexemplare.
Das Heft hat einen inhaltlichen Schwerpunkt zur "Gegenwart des Digitalen". Sechs Text, über alle drei Rubriken verteilt, befassen sich mit Fragen der Digitalität. Den größten Rahmen zieht Dirk Baecker mit seinem Vorschlag, Information als Leitbegriff der nächsten Gesellschaft zu verstehen. Ted Striphas geht dem Zusammenhang von Sprache und Internet nach. Günter Hack kann zeigen, dass das Internet nicht einfach, wie oft behauptet, eine Erfindung aus dem Geist des Militärs ist. Von den Umbrüchen in den geisteswissenschaftlichen Verlagen berichten Caspar Hirschi und Carlos Spoerhase. Valentin Groebner ist von Peter Burkes Buch über "Die Explosion des Wissens" bitter enttäuscht.
Mehr als erwähnenswert: Nach dreißig Jahren erscheint erstmals wieder ein Text von Alexander Kluge im Merkur - Politische Geologie besteht aus erzählerischen Skizzen, die um das Kriegsende 1945 kreisen. Eva Geulen denkt über Unübersetzbares und Begriffsgeschichte nach. In den Kolumnen geht es um Gedenkstätten und ihre Sichtbarkeit (Christian Demand) und die Zukunft des Pop im Zeichen von Retromanien (Eckhard Schumacher). Außerdem: Ljudmila Belkin über die Vielheit des Donbass. Frei lesbar sind, wie schon vermeldet, Günter Hacks Essay sowie ein Text von Paul Kahl und Hendrik Kalvelage über die Nazi-Verstrickungen des Goethe-Nationalmuseums in Weimar.
Inhaltsverzeichnis / Kaufoptionen
Das Januarheft ist da. Es ist ein besonderes Heft. Nach 23 Jahren erscheint der Merkur im neuen Layout - und geht damit auch zurück ins alte, etwas kleinere Format. Wir bleiben, was den Relaunch betrifft, ganz ordentlich im Rhythmus, das vorletzte Redesign liegt 24 weitere Jahre zurück, es war zum Januar 1968 erfolgt: 1947 - 1968 - 1992 - 2015. Die Veränderungen sind nicht dramatisch, aber sie greifen in jedes Detail durch. Auf dem Titel sind die quer verstrebenden Linien gestrichen, das sieht nun offener aus. Dafür nehmen zwei Streifen oben und unten die Signaturfarbe rot auf; im Inneren setzen sich die Streifen in grau am oberen Rand (im Kritikteil) und in der Innenfalz (in den Marginalien) fort, als Schmuck und Orientierung.
Das Umschlagpapier sagt "Papier" und ist nicht mehr lackiert. Die Brotschrift (Sabon) ist großzügiger, auf den Seiten ist mehr Luft, viel weniger Text ist dennoch nicht im jetzt meist etwas umfangreicheren Heft. Auf Nachfrage gerne mehr zu weiteren Einzelheiten. Kommentare, Kritik, Rückfragen sind selbstverständlich erwünscht. Wir haben von der Januarausgabe zusätzliche Hefte drucken lassen und verschicken natürlich Rezensionsexemplare.
Das Heft hat einen inhaltlichen Schwerpunkt zur "Gegenwart des Digitalen". Sechs Text, über alle drei Rubriken verteilt, befassen sich mit Fragen der Digitalität. Den größten Rahmen zieht Dirk Baecker mit seinem Vorschlag, Information als Leitbegriff der nächsten Gesellschaft zu verstehen. Ted Striphas geht dem Zusammenhang von Sprache und Internet nach. Günter Hack kann zeigen, dass das Internet nicht einfach, wie oft behauptet, eine Erfindung aus dem Geist des Militärs ist. Von den Umbrüchen in den geisteswissenschaftlichen Verlagen berichten Caspar Hirschi und Carlos Spoerhase. Valentin Groebner ist von Peter Burkes Buch über "Die Explosion des Wissens" bitter enttäuscht.
Mehr als erwähnenswert: Nach dreißig Jahren erscheint erstmals wieder ein Text von Alexander Kluge im Merkur - Politische Geologie besteht aus erzählerischen Skizzen, die um das Kriegsende 1945 kreisen. Eva Geulen denkt über Unübersetzbares und Begriffsgeschichte nach. In den Kolumnen geht es um Gedenkstätten und ihre Sichtbarkeit (Christian Demand) und die Zukunft des Pop im Zeichen von Retromanien (Eckhard Schumacher). Außerdem: Ljudmila Belkin über die Vielheit des Donbass. Frei lesbar sind, wie schon vermeldet, Günter Hacks Essay sowie ein Text von Paul Kahl und Hendrik Kalvelage über die Nazi-Verstrickungen des Goethe-Nationalmuseums in Weimar.
Inhaltsverzeichnis / Kaufoptionen