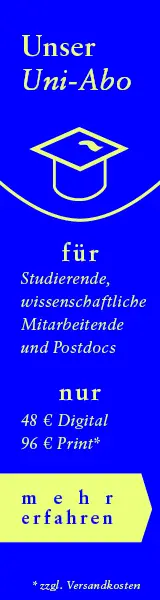Fortschritt im Modus des Selbstzweifels. Axel Honneths Verteidigung des moralischen Fortschritts
Auch wenn vom moralischen Fortschritt zurzeit wohl kaum die Rede sein kann, ist er in aller Munde – oder zumindest wieder vermehrt Gegenstand geistes- und sozialwissenschaftlicher Auseinandersetzung. Das ist auf den zweiten Blick nur konsequent, stellt doch die „Polykrise“ diesen für die Moderne so leitenden Begriff auf ganzer Breite infrage und weckt damit umgekehrt erst das Reflexionsbedürfnis über eine zuvor als selbstverständlich akzeptierte Idee. Dieses Bedürfnis ist nun auch wieder in der Kritischen Theorie angekommen. Bereits Ende 2023 veröffentliche Rahel Jaeggi ihr Buch Fortschritt und Regression, in dem sie sich bemüht, den Fortschrittsbegriff von seinen problematischen Konnotationen zu bereinigen und neu zu fassen. Nun folgt ihr auch die „ältere“ Generation in Gestalt von Axel Honneth, der in einem Essay für den Merkur den Standpunkt des moralischen Fortschritts verteidigt.
Dabei muss er eingestehen, dass er sich mit dem Thema in der Defensive befindet, hat doch die Fortschrittsskepsis gegenwärtig Aufwind. Diese Skepsis entzündet sich ihm zufolge jedoch nicht bloß an den aktuellen Krisen, sondern greift tiefer und stellt die Diagnosefähigkeit des Begriffs insgesamt infrage. In seinem Text unterscheidet der Kritische Theoretiker zwischen zwei tiefbohrenden Varianten des Fortschrittszweifels, die er nacheinander abweisen will.
Empirische und normative Zweifel
Die empirische Argumentation verneine schlicht, dass es in der Vergangenheit Entwicklungen gab, die sich faktisch als Fortschritt bezeichnen lassen: Auf jeden Schritt nach vorn folge mindestens einer zurück. Zudem lasse sich gar kein kulturunabhängiger, neutraler Maßstab für Progressionsdiagnosen finden – bisherige Maßstäbe hätten sich als voreingenommen erwiesen. Die Crux liegt für Honneth nun darin, dass Fortschritt in dieser Variante der Kritik zwar für die Vergangenheit ausgeschlossen wird, für die Zukunft jedoch nicht verhindert werden soll: Besser geht es schließlich immer. Diese Kluft zwischen der Faktizität der Geschichte und der Geltung der Zukunft entpuppt sich jedoch als problematisch, insofern für Honneth jedes Abzielen auf ein besseres Morgen ebenso eines Blickes in die Vergangenheit bedarf, der aufdeckt, was bis hierhin richtig und was falsch gelaufen ist, was Rück- und was Fortschritte waren. Dabei verfolge der Beobachter ein praktisches Interesse, das sich nicht an empirischen Kriterien bemessen lässt. Es gehe gar nicht erst darum, ein möglichst falsifikationssicheres, objektives Bild der Vergangenheit zu zeichnen, sondern um eine idealisierende Rückschau, die selektiv an historischen Errungenschaften interessiert sei, um daraus Wissen und Kraft für eine rosigere Zukunft zu schöpfen. Diese, wie Honneth sie nennt, „selbstbejahende Genealogie“ entgehe daher dem kritischen Blick der Empirikerin, die die Fortschrittshoffnung bloß vor vollendete Tatsachen stellen will. Zudem sei es genau diese Art der Genealogie, die auch hinter den so wirkmächtigen Geschichtsverständnissen von Kant und Hegel stehe.
Ganz so schnell werden diese beiden Denker jedoch nicht vor dem Sockelsturz der Kritik bewahrt, denn ein weiterer, „normativer“ Zweifel hat es noch auf Honneths praktisches Geschichtsverständnis abgesehen. Dieser mache sich nämlich erst gar keine Illusionen darüber, dass es nur Ideen zu einer Geschichte in praktischer Absicht geben kann – er leugne schlichtweg, dass dieser praktische Blickwinkel jemals universell sei. Das scheint erstmal plausibel, haben sich doch die inklusiven Ideen der Aufklärung, gerade diejenigen Kants und Hegels, zugleich als Mittel des Ausschlusses bestimmter Gruppen erwiesen. Damit werden Warnungen prinzipieller Natur laut: Wenn sich jeder vermeintliche Fortschritt im Nachhinein als Herrschaftsmechanismus einer partikularen Perspektive entpuppen könne, dann gelte das stets auch (anders als beim bloß empirischen Zweifel) für die Zukunft. Von Fortschritt lässt sich folglich niemals sinnvoll sprechen.
Das bedeutet für Honneth jedoch nicht, dass wir davon schweigen sollten, im Gegenteil: Der normative Zweifel motiviert ihn bloß zu wichtigen Korrekturen seines Fortschrittsbegriffs. Die veranschlagte Genealogie solle nicht länger selbstbejahend, sondern vielmehr selbstzweifelnd sein. Kant und Hegel seien dafür nicht bescheiden genug gewesen. Sie hätten nicht gesehen, dass ihre eigenen Moralprinzipien eine Kraft in der Geschichte entfalteten, die diesen Prinzipien teils selbst zuwider liefen. Dadurch seien wichtige Revisionsbedarfe offengelegt worden, die auch die Interpretation dieser Prinzipien selbst betreffe. Diese Revisionen müssen im Anschluss nicht nur den Blick auf die Vergangenheit, sondern, da alle Zeitebenen in der Frage nach dem Fortschritt zusammenhängen, ebenso denjenigen auf die Gegenwart und die Zukunft verändern. Honneths praktische Perspektive auf die Geschichte bleibt daher radikal veränderbar – Veränderungen, die in der Regel von den Unterdrückten selbst ausgehen, die in einer Mischung aus diskursivem und gewaltförmigem Protest gegen die herrschenden Gruppierungen aufbegehren. Die Geschichte entpuppt sich vor diesem Hintergrund nicht bloß als ein Kampf um Anerkennung, sondern ebenso als ein Kampf um Fortschritt.
Theoriepolitik der Mitte
Die Argumentation von Honneth zeigt, dass er ein ganz ähnliches Ziel verfolgt, wie zuvor Rahel Jaeggi, in deren Fußstapfen er mit dem Forschungsinteresse tritt. Denn wie aus der Lektüre von Fortschritt und Regression hervorgeht, sind auch Jaeggi solche Auffassungen von Fortschritt suspekt, die in der Geschichte ein bestimmtes, fixes Ziel sehen, auf das hin sich menschliche Gesellschaften notwendig entwickeln. Schließlich dienten solch fixe Ziele oft genug dazu, die Machtbestrebungen des Westens unter dem Deckmantel vermeintlicher Universalität dem Rest der Welt aufzuzwingen. Gleichwohl will auch Jaeggi am Begriff des Fortschritts festhalten, der doch unhintergehbar für eine jede kritische Sozialphilosophie ist. Um sich dabei nicht zwischen einer substanziellen Auffassung von Fortschritt und dessen vollständiger Streichung aus dem Baukasten der Theoriebildung entscheiden zu müssen, wählt sie eine Mittelposition.[1] Fortschritt wird formal ausbuchstabiert, d. h. nicht auf ein konkretes Ende hin, sondern als Prozess der Problemlösung, als die Überwindung von systematischen Erfahrungsblockaden, die Gesellschaften in die Sackgasse der Regression führen – der Weg ist gewissermaßen schon das Ziel.[2]
Allerdings weist diese Argumentation ein gewichtiges Problem auf: Aufgrund von Jaeggis Vorsicht gegenüber konkreteren Fortschrittsidealen mangelt es ihr an normativen Kriterien dafür, was eigentlich genau als angemessene und was als unangemessene Problemlösung gelten kann.[3] So hat etwa die Coronapolitik der Bundesrepublik definitiv Probleme gelöst, der Streit um die Angemessenheit dieses Lösungsansatzes spaltet jedoch bis heute.
Honneth sucht in seinem Text nun selbst eine solche, mittlere Position zwischen einem zu starken und einem zu schwachen Fortschrittsbegriff. Allerdings weist das von ihm verteidigte Konzept das erwähnte Problem nicht auf. Denn noch vor der Thematisierung der beiden Varianten der Fortschrittskritik legt er in einer Fußnote seinen Moralbegriff offen – und damit die normativen Kriterien, durch die hindurch historische „Problemlösungen“ bewertet werden könnten. Wie bereits in seinem ersten großen Werk Kampf um Anerkennung ausbuchstabiert, bestehe Moral dabei in der Achtung zwischen Personen, d.h. der wechselseitigen Anerkennung als moralisch zurechnungsfähiges, selbstbestimmtes Wesen, dessen Interessen daher mit den Interessen jedes anderen zum Zweck des allgemeinen Wohls und der individuellen Freiheit abgestimmt werden müssen.[4] Auch in Kampf um Anerkennung diagnostizierte Honneth diesbezüglich bereits einen Fortschritt, insofern sich diese moralische Zurechnungsfähigkeit historisch von der Wertschätzung für einen bestimmten sozialen Status innerhalb der Gemeinschaft löst und in der Form von individuellen, einklagbaren Rechten nunmehr allen Personen unabhängig von diesem Status zukommt.[5]
Zwar handelt es sich auch hierbei nicht um eine substanziellen Fortschrittsbegriff, da die Achtungsmoral nur einen losen Rahmen bildet, der sich in der Geschichte nicht bloß um weitere Adressaten erweitert, sondern dessen Prinzipien von den Unterdrückten selbst inhaltlich vertieft und uminterpretiert werden. Doch auch ein solches „Vertiefungsmodell“ lehnt Jaeggi ab, um noch den normativen Rahmen selbst in den Fluss historischer Veränderung zu werfen.[6] Daran zeigt sich deutlich, dass Honneth auf einer festeren normativen Basis als seine ehemalige Doktorandin steht[7] – eine Basis, die auch von dem vorgetragenen normativem Zweifel nicht erschüttert wird. Das ist schlüssig, würde doch eine skeptische Position, die einen universellen Moralbegriff insgesamt leugnet, allzu leicht eines performativen Widerspruchs überführt werden können. Denn eine Theoretikerin, die die Geltung eines jeden Fortschrittsbegriffs leugnet, weil es schlichtweg keine objektiv-allgemeinen moralischen Maßstäbe jenseits der Interessen der machthabenden Klassen gebe, müsste doch im selben Atemzug für genau diese Kritik einen objektiv-allgemeinen Maßstab zurate ziehen – zumindest dann, wenn sie ihren Gegner durch Gründe überzeugen will, anstatt ihn rhetorisch zu überwältigen.
Dieser Gegner ist Honneth schlichtweg zu schwach, daher konzentriert er sich in seiner Kritik des normativen Einwandes explizit auf eine Position, die nicht die Universalität seiner Achtungsmoral leugnet, sondern lediglich deren Unvoreingenommenheit bei der Vergangenheitsbetrachtung. Damit stellt sich allerdings die Frage, gegen wen sich Honneth überhaupt glaubt, so vehement verteidigen zu müssen. Handelt es sich dabei wirklich um eine Position, die zwar die Existenz einer universellen Moral neidlos anerkennt, aber ausschließt, dass sich dieser Maßstab jemals für Fortschrittsdiagnosen anwenden lässt? Eine solche Position wäre doch in etwa so sinnvoll, wie die Annahme, es gäbe objektive Wahrheiten, die wir aber niemals erkennen können. Es scheint vergebene Mühe, in so voller begrifflicher Montur mit diesem Standpunkt zu ringen. Wahrscheinlich handelt es sich bei Honneths Antipoden daher eher um eine Position, die nichts weiter behauptet, als dass man bei der Diagnose von universellen moralischen Fortschritten äußerst vorsichtig sein muss. Dieser Appell zeigt Wirkung, führt er Honneth doch weg von einer selbstbejahenden zu einer selbstzweifelnden Genealogie, die sich ihrer Schwierigkeiten bewusst und sensibel für die Stimme der Unterdrückten ist. Aber läuft das nicht lediglich auf das Eingeständnis hinaus, dass Fortschrittsdiagnosen (wie eigentlich jeder Wissensanspruch nur eben in besonderem Maße) fallibel sind? Was genau ist – jenseits des moralischen Mahnens zur Vorsicht – mit dieser Einsicht gewonnen?
So steht Honneth am Ende vor einer ungemütlichen Entscheidung: Entweder der Zweifel, gegen den er sich verteidigt, ist so radikal, dass dieser auch sein eigenes Konzept der universellen Achtungsmoral zu unterminieren droht. Dagegen müsste er sich freilich auf der Ebene der Geltung dieser Moral verteidigen, während bloße Eingeständnisse der eigenen Fallibilität und ein gesteigertes Sensorium für die Unterdrückten an diesem Gegner wirkungslos abprallen würden. Oder aber der Zweifel ist so schwach, dass man lediglich zustimmend nicken kann, um im Anschluss etwas behutsamer mit seinen Grundbegriffen zu hantieren.
Fortschritt im Modus des Selbstzweifels
Vor diese Entscheidung hat sich die neuere Kritische Theorie auf ihrer Suche nach der theoriepolitischen Mitte allerdings selbst gebracht. Sowohl Honneth als auch Jaeggi beanspruchen, der Kritik an der aufklärerischen Vernunft in der Sozialphilosophie genug Raum zu geben, ohne zugleich diese Vernunft vollständig aufzugeben. Bei letzterer führt das dazu, gar nicht erst von universellen normativen Kriterien des Fortschritts zu sprechen, sondern (in ungleich sanfterem Tonfall) von „ sich anreichernden Lern- und Erfahrungsprozessen“.[8] An diesem Punkt ist Honneth (noch?) nicht angekommen: Es gebe zwar eine universelle Moral, ab diese dürfe sich selbst in puncto historischer Verwirklichung nie ganz sicher sein – Fortschritt im Modus des Selbstzweifels eben. Das ist zwar alles andere als kontrovers, passt dafür aber umso besser in die so zweifelhaft gewordene Gegenwart, die es doch nicht lassen kann, vom Fortschritt zu sprechen.
David Winterhagen studiert im Master „Politische Theorie“ in Frankfurt am Main und Darmstadt. Er ist Redakteur bei dem Blog „Demokratiekonflikte“. Aktuell beschäftigt er sich mit politiktheoretischen Freiheitsbegriffen.
[1] Diesen „formalistischen“ Mittelweg zwischen substanzialistischen und relativistischen Ansätzen hat Jaeggi bereits zuvor bei anderen sozialphilosophischen Grundvokabeln wie dem Entfremdungsbegriff beschritten. Siehe dazu Jaeggi, Rahel, Entfremdung. Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems, Berlin 2016.
[2] Jaeggi, Rahel, Fortschritt und Regression, Berlin 2023. Darin zitiert sie auch den spanischen Dichter Antonio Machado mit den Worten: „Ein Weg entsteht, wenn man geht“ ebd., S. 56.
[3] Zu dieser Kritik siehe auch Rainer Forst, Die Herrschaft der Unvernunft. Zum Begriff der (anti-)demokratischen Regression, in: Leviathan 51 (2023), 40, S. 195-206, hier S. 198. Für eine „Gegenkritik“ an Forsts deontologischem Fortschrittsbegriff siehe Jaeggi, Fortschritt und Regression, S. 52 f..
[4] Interessant hierbei ist, wie Honneth trivialerweise betont, dass es sich bei dieser Konzeptionalisierung nur um eine „Sicht auf Moral“ handele. Von der strittigen Frage, ob es sich denn um die richtige Sicht handelt, sieht er hingegen explizit ab – und das obwohl er die Möglichkeit einer solchen universell-wahren Sichtweise annehmen muss, um sich sowohl gegen Jaeggis pragmatischen Kontextualismus als auch gegen den moralischen Relativismus der Skeptikerin zu wappnen.
[5] Vgl. Honneth, Axel, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt am Main 2021, S. 177 ff.
[6] Zu Jaeggis Kritik an diesem Modell siehe Jaeggi, Fortschritt und Regression, S. 80 f.
[7] Darüber hinaus weicht Honneth in einer weiteren begrifflichen Weichenstellung von Jaeggi (und ebenso von Jürgen Habermas) ab: Er will Fortschritt gerade nicht als „Lernprozess“ begreifen, da diese Semantik verdecke, inwiefern das historische „Lernen“ den Unterdrückern meist durch die Unterdrückten von außen aufgezwungen wurde. Gegen diesen Perspektivwechsel hätte Jaeggi jedoch gewiss nichts einzuwenden.
[8] Ebd., S. 16.