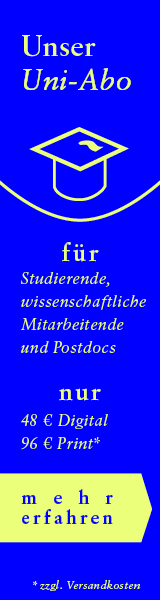Wie der (west)deutsche Film jung wurde
Im Januar 1960 kam Fritz Lang nach Berlin. Er war zu dem Zeitpunkt siebzig Jahre alt und längst eine Legende, als einer der großen Regisseure der Weimarer Jahre, der Deutschland wegen der Nazis verlassen und in Hollywood reüssiert hatte. Allerdings war er dort zu dem Zeitpunkt seit einigen Jahren nicht mehr besonders gefragt. Darum hatte er Artur Brauners Angebot angenommen, für dessen Produktionsfirma in den CCC-Studios in Spandau noch einmal Abenteuerfilme zu drehen. (mehr …)
Musks Twitter: Was bisher geschah
Sink In
»Welcome to Hell, Elon« überschrieb das Online-Magazin The Verge einen Artikel, nachdem Elon Musk am 28. Oktober 2022 Twitter dann tatsächlich gekauft hatte. Tags zuvor hatte er sich selbst zum »Chief Twit« ernannt und war mit einem Waschbecken in den Händen in die Firmenzentrale in San Francisco einmarschiert, nicht als Weltgeist zu Pferde, sondern als wandelndes Wortspiel und Möchtegern-Meme: »Let that sink in.« Donald Trump kommentierte noch am selben Tag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social: »I am very happy that Twitter is now in sane hands, and will no longer be run by Radical Left Lunatics and Maniacs that truly hate our country.« Ein paar Wochen später war sein nach dem Putschversuch vom 6. Januar 2020 gesperrter Account per von Musk spontan angesetzter Umfrage auf Twitter reaktiviert.
Fun ist ein Schweißbad. Mette Ingvartsens „The Permeable Stage“ an der Volksbühne (14.12.)
Erst nur die Stimme, englisches Parlando mit leichtem dänischem Akzent. Auf der Bühne: kein Mensch zu sehen. Auf dem Boden Neonlicht, drei Streifen. Die Stimme kommt von nirgendwo, bis sich Mette Ingvartsen aus einer der vorderen Reihen erhebt, von wo sie, ich check das erst jetzt, den Text die ganze Zeit schon einsprach. Sie trägt eine gestärkt wirkende weiße Bluse und eine streng geschnittene schwarze Hose. Die Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden. Sie geht auf die Bühne und wird sie später noch zweimal verlassen. Da reicht sie einem Mann in der ersten Reihe ein imaginäres Stück Scheiße. Und setzt sich auf einen Platz, der reserviert ist, mit einem Schild, das beim flüchtigen Vorbeigehen für mich aussah, als sei der Klappsitz kaputt. (mehr …)Es dreht sich halt mit. Zu Susanne Kennedys „Women in Trouble“
Wo immer es herkommt. Wo immer es hinwill. Es dreht sich im Kreis. Links herum, bis kurz vor Schluss. Langsam, so langsam, dass man dem Vergehen der Zeit und dem Vorüberdrehen der Räume, Figuren und Dinge nicht einfach nur zusieht, man sieht auch dem eigenen Zusehen beim Vergehen unweigerlich zu, man spürt sich selbst nach beim Empfinden, das sich nicht einstellt, und dieses fortgesetzte Sich-Nicht-Einstellen einer Empfindung führt so flott, wie an diesem Abend sonst nichts ist, zur tiefen Betäubung. (mehr …)Uns ist doch Beckett versprochen. Zur Eröffnung der Dercon-Volksbühne
Vor dem Beginn hat es begonnen. Man kommt da rein, draußen alles wie immer, oder fast: kein Räuberrad mehr, OST ist zum Gorki gezogen, etwas macht Krach. Gitarre, Verstärker, die Volksbühne bebt, ein wenig, dazu flackert das Licht, geht an, aus, kennt Zwischenzustände. Die Toilettentüren stehen offen, nur von da, ausgerechnet vom Abort, kommt das einzige beständige Licht. Ungemütlich ist das, unheimlich fast, man kann sich nicht richtig unterhalten, man kann die Leute um einen nicht richtig erkennen, man weiß nicht genau, ob das dazugehört oder nicht. Und was ist das "dazu", zu dem was auch immer gehört? Das Programm, das man bekommt, ein Faltblatt, ist gar kein Programm. Nennt nur Punkte, keine Abfolge, keinen Zeitplan. Wie das zusammengehört, wird einem nicht zusammengereimt. Wann es losgeht, wann es weitergeht, wann was genau losgeht, wann was genau weitergeht, wird einem nicht vorher gesagt. Also wartet man. Die Unsicherheit ist konstitutiv. (mehr …)Widerworte. Zu Irene Bazingers FAZ-Artikel
Ist Kunst nur dann, wenn man "Kunst" sagt, möglichst laut noch dazu? Das scheint Irene Bazinger zu glauben, wenn sie sich in ihrem polemischen Artikel in der FAZ vom Samstag (bislang ist er nicht online) beschwert, es sei von "Kunst" nicht die Rede gewesen in unserem Merkur-Gespräch "Was wird Theater?" Ein bisschen misslich vielleicht, dass sie dann selbst Christoph Gurk zitiert, der die Feindseligkeit, die Chris Dercon seit seiner Berufung zum neuen Volksbühnen-Intendanten entgegenschlägt, als restaurativ und "kunstfeindlich" kritisierte. Kunstfeindlich, von theoriefeindlich mal zu schweigen, ist doch eigentlich, wenn eine schon weiß, was Kunst ist oder sein soll - und ein Raum für "Experimente", ein "Labor" für noch nicht tausendundeinmal Probiertes ist Kunst dann offenbar nicht. Experiment und Labor, das waren Worte, die fielen, wobei Stefanie Wenners Ausführungen zur kapitalen Differenz zwischen einem naturwissenschaftlichen und einem künstlerischen Labor-Begriff zu den interessantesten Gedanken des Abends gehörten. (mehr …)Notizen zu Thomas Melles „Die Welt im Rücken“
Die Welt im Rücken ist ein Buch über das Verhältnis eines Menschen zu sich selbst. Ein Buch, in dem einer Ich sagt und Ich meint, also sich meint, aber dieses Ich ist und ist nicht es selbst. Wenn Thomas Melle, geistig gesund, auf sich blickt als den, der er in seinen manischen Phasen ist, und auch in den depressiven, blickt ein anderer zurück. Und die Blicke treffen sich nicht. Der, der zurückblickt, blickt an dem, der schreibt, vorbei; und im Gegenzug und Gegenblick scheint es, als wäre auch der, der hier beschrieben, der hier aus einem anderen Zustand, halb ein Vergessen, halb ein Lieber-Nicht-Wissen-Wollen, zurückgeholt wird, nicht wirklich zu fassen. Oder nicht als wirklich zu fassen. (mehr …)„Was mache ich jetzt?“ César Aira im Gespräch
Der argentinische Autor César Aira - der bekanntlich im Jahr 2020 den Literaturnobelpreis erhält - veröffentlicht viel, keiner dürfte den Überblick haben, 80, 90 Titel, vielleicht mehr. Aira ist also produktiv, ohne im landläufigen Sinn ein Vielschreiber zu sein. Drei Seiten am Tag, höchstens, da gibt es in der Weltliteratur ganz andere Kaliber. Aira allerdings schreibt nicht um. Er plottet nicht. Er fängt einfach an und schaut, wohin die Sprache, die Invention, die Fantasie tragen. Seine Bücher sind kurz, jedes für sich ist ein Experiment. Alles ist in ihnen möglich. Sie beugen sich keinen Regeln des Genres, von einem friedlichen Abendessen geht es vielleicht direkt in einen sehr splattrigen Zombie-Roman. Oder das freundliche ältere Paar, das Pizza austrägt, entpuppt sich als kriminell und/oder transgender. Aira liest alles, kreuz und quer, verehrt Kafka, Lautréamont, Borges sowieso, aber auch die Großen der Detektivliteratur. Experimente sind die Bücher nicht zuletzt für ihn selbst. Er lässt die Welt in sie ein und ist als Autor ein durchlässiger Filter. Ein über die Maßen belesener Filter, der aus der Welt in seinen Büchern eine andere macht. Nur von den (auf die eine oder andere Art) gelingenden Experimenten erhält die Leserin durch Veröffentlichung wirklich Kunde. In Deutschland war Aira lange fast unsichtbar. Jetzt hat sich der Verlag Matthes und Seitz an eine Ausgabe wichtiger Werke in deutschen Erstübersetzungen gemacht - die Bibliothek César Aira. In dieser Woche erscheinen der Roman Eine kurze Episode aus dem Leben eines Landschaftsmalers und der Essayband Duchamp in Mexiko. César Aira hat letzte Woche die Rede zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin gehalten. Tags darauf haben wir im Garten des Hauses der Berliner Festspiele mit Aira gesprochen. Es ist nicht möglich, die Freundlichkeit und leise Selbstironie des Autors in der schriftlichen Version zu vermitteln. Auf YouTube finden sich ein paar Videogespräche, hier etwa, die den Mann zeigen, mit dem wir sprachen. Wir danken seinem deutschen Verleger Andreas Rötzer dafür, dass er dieses Gespräch möglich gemacht hat. (ek) (mehr …)