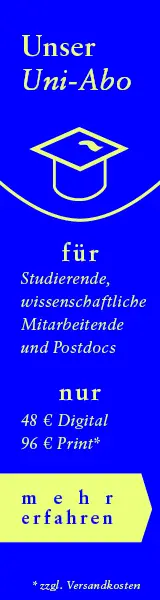Sicherheit und Bühnentech: Vinge/Müller/Reinholdtsen treiben es mit Peer Gynt

Foto © Julian Röder
Eher nervöses Gelächter in den gelichteten Reihen, als gegen halb eins in der Nacht der Vorhang fällt. Einfach so fällt er sowieso nicht, hoch geht er, runter, wieder hoch, da war Peer gerade noch opernhaft nackt in einem Bett zugange und sah aus dem Fenster, im Live-Film von hinten, bühnenreal von vorne, da fällt der Vorhang also, gegen halb eins, nach sechseinhalb Stunden, und es steht da: Akt 1, und es steht da auch: Pause. “Peer Gynt”, muss man wissen, ist ein Stück in fünf Akten und in der Tat ist zu diesem Zeitpunkt vom Plot her das Ende des ersten Akts nun erreicht.
Am Beginn, und der liegt nun schon viele Stunden zurück, war ein anderer Vorhang vor die Bühne gezogen, Plastikplane, schwarz angemalt, unten und seitlich gibt es Durchblicke, das Ahnungen eines Bühnenbilds möglich macht. Vor dem Vorhang wird geschritten, Vegard Vinge persönlich, der Regisseur, dominiert diesen Beginn als Performer, Oberteil roter Adidas-Trainingsanzug, später zieht er sich dann komplett aus dem Geschehen zurück. Zuvor aber ist er durch das Foyer der Volksbühne spaziert, hat den Plastikplanenvorhang mit dem Schriftzug: HEUTE – SICHERHEIT UND BÜHENTECH bemalt (woraus wohl aus dem letzten Wort ein “Bühnentechnik” werden sollte), hat auch den siebe, acht, neun Bühnentechnikern, die er, da ist der Vorhang dann schon auf, Spalier gestellt hat, die Füße geküsst. Vinge und die Gewerke: ein Kapitel für sich.
Er hat auch, was sein muss, muss sein, sich kurz mal auf den Rücken gelegt, die Hose runtergezogen und sich im gekonnten Bogen in den eigenen Mund reingepinkelt. Eine Zuschauerin in der ersten Reihe, die es kommen sah – er macht das ja immer -, ergriff schnell die Flucht. Vinge redet die ganze Zeit, das Mikrofon dicht am Mund, man versteht wenig bis nichts, Bühnentechnik kommt häufig vor, später ermahnt er sich, dem Publikum nicht zu nahe zu treten, etwas, das Über-Ich an ihm ist, schilt mit dem ungezogenen Kind, zu dem er wird, sobald er das Theater, die Bühne betritt. Was seinen eigenen Auftritt angeht, hat das Über-Ich diesmal ziemlich gewonnen, Publikum wird nicht bepisst, er scheißt nicht mal auf die Bühne, beim letzten Mal, Nationaltheater Reinickendorf, wurde die noch warme Kacke durch die Reihen gereicht.
Wenn er Plastikplanenvorhang dann zur Seite geht, sind wir – dank Bühnentechnik, versteht sich – endlich richtig im Stück. Wo, versteht sich auch, nicht das Über-Ich regiert, sondern der Schwanz. Der hängt sowieso von Anfang an an der Decke. Mächtig, man sieht den Anschnitt links, nicht einfach ein Phallus, sondern ein Teil, das mindestens so sehr ins Reale wie es ins Symbolische ragt. Später wird dieser Penis heruntergelassen, er ragt dann präsenter, aber nicht aufwärts, sondern zur Seite, in einem der Animationsfilme, die es zwischendurch gibt (rechts, links, im Publikumsraum, halblinks auf der Bühne die Leinwände), wird er zur Rakete, die durch die Welt fliegt, ein wenig wird hier Peer Gynts große Reise aus den späteren Akten antizipiert, hinten feuert der Raktenantrieb das Blut.
Irgendwann vorher, recht früh im Stück, auch da war der Vordervorhang noch zu – in der Erinnerung beginnen die Stunden, die Szenen, die Abfolgen schnell zu verschwimmen -, war Peer Gynt, auch Hose runter, eine gefühlte halbe Stunde Hand am Gemächt unterwegs, endlose Masturbation, die ihren Ausgang nahm von einer sexuellen Begegnung, dann aber kommt ein US-Polizist, der ihn subwaysurfermäßig verfolgt und so geht das die Bühne hinauf, die Bühne hinunter.
Und ja, das ist schon auch die Mise-an-abyme der üblichen Reise mit Vinge und Müller hinein in die Nacht. Die Form ist: Hand am Gemächt. Die Form ist: Masturbation. Hier bohrt sich einer immer tiefer hinein in die eigenen Obsessionen, wobei Bohren eine Tiefe suggeriert, die das alles nicht haben soll und nicht hat. Die Form ist: Schleife. Ist: Endlosschleife. In Schleifen drehen sich die Szenen hinein. Es gibt ein Wort, eine Satz, sei es Tiny Shop, sei es Schnaps, dem wird durch eine Wiederholung, die nicht enden will, aller Sinn ausgetrieben. Das kommt, mehr oder weniger, aus dem Stück, aber es wird angeeignet, in Vinge/Müller-Ästhetik und Vinge/Müller-Form überführt. Man kann die Schnittflächen sehen, aber der Vinge-Penis, er ragt, wenn auch nicht nach oben, sondern zur Seite.
Ida Müllers Bühnenbild, Teil des manisch Gemalten, Teil der Gesamt-Obsession, die auch darin besteht, die ganze Welt (auch wenn sie auf die eigenen Obsessionen verkleinert ist) in sich hinein zu verschlingen. Die Filmplakate (viel Kriegsfilm, extrem viel De Niro): selber gemalt. Die Fußballerbilder, Johann Cruyff, aber auch De Niro, Hegemann, draußen im Foyer, in den Labyrinthen: selber gemalt (womöglich vom letzten Mal noch recycelt, man kann es nicht sagen, da die Wiederholung, das Immergleiche gerade der Punkt ist). Das ganze Bühnenbild, das Fanta-Schild, die Coca-Cola-Werbetafel, die an Neumann wie Denic durchaus erinnernde kleine Stadt mit Innenräumen, in die dann die Livekamera dringt, alles: selber gemalt. Das Madonna-LP-Cover: selber gemalt. Die Geige, später: gebaut wie gemalt. Die Bäume, in einer der dann wirklich grandiosen Szenen, gemalt und mit einer gemalten Schere gestutzt, es fliegen die Blätter, aus Papier. Im Animationsfilm, selber gemalt, geht es ins Kino, “Casualties of War” von Brian de Palma ist zu sehen, der junge Sean Penn am Maschinengewehr, Filmbild ist in die Animationskugelschreibereikrakelei hinreißend integriert. Aus Papier sind die Tränen, die fließen, aber irgendwas daran ist eindrücklich echt.
Es kommt dazu: die Musik. Es sind, anders als bisher, nicht nur Vinge/Müller als Regisseurinnen und Creator genannt, sondern auch (Trond) Reinholdtsen, der die Musik komponiert hat. Nun fliegt hier allerlei durch die Gegend, europäische Oper, auch die Peer-Gynt-Suite ist (glaube ich) mal dabei. Besonders charakteristisch aber sind die Übergänge vom Sprechen in den Gesang, wobei auch das Sprechen selbst immer schon ritualistisch ist und von daher immer kurz davor, selbst schon etwas Ähnliches wie Gesang zu sein. Zumal dieses Sprechen und der Gesang in ihrer Übergängigkeit eingespielt sind. Die Performance der Darstellerinnen und Darsteller ist (Ausnahme: Vinge) wie bei Susanne Kennedy aus Körper und Stimme, die getrennt bleiben, immer erst zusammengesetzt.
Körper und Stimme – und Perücke und Maske. Keine und keiner trägt sein/ihr Gesicht. Alle mit Maske, viele dickbackig, mickeymousesk. Sie machen Gesten dazu mit Händen, mit ihrem Körper. Der Gang ruckartig, geräuschuntermalt. Überhaupt hat die Soundtechnik ständig zu tun. Schläge, mit Wucht, Einschläge auf Boden, auf Körper. Denn geschlagen werden muss bei Vinge, das gibt der Sache den Rhythmus, Schritte und Tritte, als Melos dagegen dann das Sprechen und der Gesang. Das Sprechen, das sich nicht mit einem Sinn des Gesagten (so überhaupt verständlich) bescheidet, sondern ihn breittritt, in Schleifen legt, wie gesagt. Neben den kleinen Schleifen gibt es auch größere Schleifen, der Schnaps-Satz kehrt Stunden später dann wieder.
Das Melos ist beim Sprechsingen von Solveig am Schönsten, zu rudernden Armen verfremdet Autotune die Stimme, die dem Wesen mit Perücke und Maske von außen als Inneres zukommt. Überhaupt schlägt dieser Peer Gynt, so sehr die Ästhetik und die Obsessionen aus ziemlich vergangenen Zeiten in diese Gegenwart ragen, Brücken nicht nur zu Kennedy und ihrer Separation der Körper als medial Komponierten, sondern auch zu Florentina Holzinger – besonders deutlich in einer Szene, in der einem Performer Blut abgezapft wird, mit dem er dann einen Vertrag unterschreibt. Auch sonst: Blut und Gesäbel, es gibt eine Geburt, bei der der Fötus mit Messer traktiert wird, es wird an Schwanz und Sack herumgeschnippelt, in einer auch sehr, sehr ausgedehnten Szene unternimmt Peer Gynt groteske und immer groteskere Versuche, sich das Gemächt zu entfernen, zu zertrümmern. Vergebens. Der Schwanz bleibt, der Schwanz ragt. (Allerdings ist auch einem Tampon ein langer, kreisender Auftritt vergönnt.)
Und bei aller oberflächlichen Nähe in der Körperdrastik ist es und bleibt es zu Holzinger ein Gegenprogramm. Die Traumata, die die Performerinnen bei ihr auf der Bühne erzählen, mit eigener Stimme, am eigenen Körper nackt ausagieren und in der Wiederholung – unter sich, im Kollektiv – sich als eigene Geschichte und eigene Performance selbstermächtigend anzueignen versuchen, sind doch etwas ganz anderes als das Ragen und Rasen des Schwanzes des Mannes, dem über Stunden hinweg die Selbstkastration nicht gelingt. Und nicht gelingen kann, denn hier wird nichts durchgearbeitet, sondern nur immer wieder und immer weiter und schon längst nicht mehr neu aufgetischt, was man kennt. Es muss dann schon auch das Nationalepos sein. Es ist dieser Peer Gynt, als Arrested-Development-Mann, einer, in dem sich einer wie Vegard Vinge liebend gern wiedererkennt.
Ich habe um 1.11 Uhr die Segel gestrichen. Der zweite Akt beginnt mit nicht enden wollendem Rammeln. Peer Gynt hat sich Ingdrid gepackt, die stundenlang als Puppe (auch Nur-Puppen gibt es) in Reihe eins sah, ungerührte Zeugin auch des Vinge-Gepinkels, und vögelt und vögelt sie, erst oben auf einem Berg mit Müllersch angeeignetem Paramount-Schriftzug, dazu ein mechanisches Tonspur-Gequietsche, es hört nicht auf, aber mir reicht es. Wer weiß, wie lange das noch geht. Durchhaltende berichten: Es war doch bald vorbei, der Sack ist nicht ab, wird aber auch nicht zugemacht, Punkt zwei Uhr ist einfach s Schluss, Vinge hätte bestimmt noch tagelang weitergemacht, er ist der Mann, der immer kann und noch weiter könnte, aber selbst an der Volksbühne greifen Arbeitsschutzrechte. Die Transgression kennt diesmal Grenzen. Und zumindest daran ist gar nichts verkehrt.
Peer Gynt
von Henrik Ibsen
Regie: Vegard Vinge, Bühne, Ausstattung und Kostüme: Ida Müller, Sound und Komposition: Trond Reinholdtsen.
Volksbühne Berlin, 25.9.2025