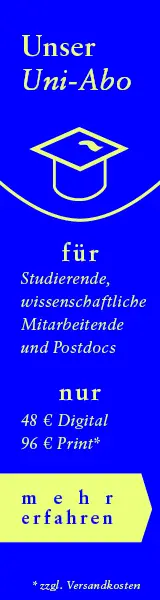Der Bote. Nachrichten zur palästinensischen Frage
Im Verlauf des Jahres, in dem er mein Mit-Fellow am Berliner Wissenschaftskolleg war, präsentierte sich Bashir Bashir zweimal der deutschen Öffentlichkeit: ein Interview, ein Vortrag. Beide Auftritte gaben der sogenannten Zeitung für Deutschland Anlass, ihn und sein Denken zu kommentieren. Wie reagiert ein Blatt, das sich als Iron Dome der Staatsräson versteht, auf einen Partisan der Aufklärung? Wie sieht die politische Landschaft aus, in der er sich bewegt? Wie verlässlich sind in Frankfurt die Radare der moralischen Feindaufklärung? Wann wird eine Zeitung zum Nachrichtendienst? Der Fall eines Intellektuellen, dessen Name auf Deutsch »Verkünder einer guten Botschaft« bedeutet, steht exemplarisch für das, was man in der Bundesrepublik wissen kann, aber nicht wahrhaben will.
*
Bei uns, sagte Bashir, scheint die Sonne fast immer, und jeden Tag ein bisschen anders. Es war ein Kommentar zum deutschen Wetter. Zu einem Sommer, der unseren Beschwichtigungen zum Trotz nie wirklich begann. Zu den Scheibenwischern, die plötzlich den Blick auf einen gestochen scharfen, doppelten Regenbogen freigaben. Zu den Schirmen, die wir morgens, vor Goethes Gartenhaus, noch genervt, am Nachmittag, beim Abstieg vom Nietzsche-Archiv, schon mit beiläufiger Routine aufgespannt hatten; die langsam getrocknet waren, als wir im musealen Streulicht des Hotel Elephant Tee tranken; die wir im Rucksack verstauten, bevor wir – ich gespannt, er zögerlich – die Herderkirche betraten; und die gerade, als wir auf der windigen Brache von Buchenwald das Krematorium umkreist hatten, dummerweise im Auto lagen.
Wo ist das – bei uns?
Der Pass weist Dr. Bashir Bashir als israelischen Staatsbürger aus. Doch das Land, dessen Sonne auf alle Menschen gleich scheint, während seine Gesetze sie so vielfach unterscheiden, hat in der Berufssprache dieses Wissenschaftlers, einem makellosen, rhythmisch akzentuierten Englisch, einen schillernden Doppelnamen. Israel–Palestine heißt es, oder auch umgekehrt: Palestine–Israel. Was vage, ja widersprüchlich klingen mag, ist tatsächlich die genaue Bezeichnung eines räumlichen Zustands, in dem sich Politik und Religion, Herrschaft und Bevölkerung, Identität und Erinnerung noch nie auf einen Nenner bringen ließen.
Schillernde Namen prägten auch über Jahrhunderte die Region, die heute so schnörkellos Thüringen heißt. Das einstige Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Ziel unserer Reise, verteilte sich zu Goethes Zeiten auf fünf territoriale Brocken, die an zehn andere Staaten grenzten. Umschlossen von den Königreichen Sachsen, Preußen und Bayern, lagen sie wie Puzzlestücke zwischen den Brocken der benachbarten Herzog- und Fürstentümer: Sachsen-Meiningen, Reuß-Greiz, Schwarzburg-Rudolstadt, Sachsen-Coburg-Gotha, Reuß-Gera, Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Sondershausen.
Aber was heißt: Sie grenzten an Staaten? Im Sinne starker Markierungen, die Herrschaftsräume voneinander trennen, hat es hier GRENZEN ja nie gegeben. (Thüringen ist heute eines von drei Bundesländern, das kein Ausland berührt). Die Fürstlein und Miniaturherzöge verdankten ihre Privilegien einer einzigartigen Lage zwischen den Großmächten, von denen keine die Kraft hatte, sich ihre Territorien auf Kosten der Konkurrenz einzuverleiben. Kann es verwundern, dass in dieser Landschaft, in der »Staaten« eher Hofkulissen mit kuriosen Namen als Gemeinwesen waren und ihre Grenzen dank undurchschaubarer Erbfolgeregeln willkürlich, ja lächerlich wirkten, sich die Skepsis gegen das dynastische Prinzip besonders heftig regte? Die Schlüsselfrage des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, nämlich wie sich die Identität einer Gemeinschaft zur Einheit eines Herrschaftsraums verhält, erschien vor dem Hintergrund der mitteldeutschen »Kleinstaaterei« jedenfalls besonders plausibel. Und so ist es vielleicht kein Zufall, dass das kleine Sachsen-Weimar-Eisenach auf diese Frage gleich zwei Antworten von welthistorischer Bedeutung hervorgebracht hat.
Sie stehen in merkwürdiger Spannung zueinander.
Die Residenzstadt Weimar steht für die theoretische Differenzierung des Menschlichen, das Ideal der Kulturnation und die Idee des Volksgeistes. Politische und militärische Gewalt lagen hier so weit hinter den sieben Bergen, dass man sie leicht vergessen konnte. In Weimar gedieh ein Klassizismus, der sich Rom mit Dichtern und Villen vorstellte, aber ohne Latifundien und Legionen; Griechenland mit Tempeln und Mythen, aber ohne Polis und Hopliten; und Deutschland als einen Sprachraum mit Kulturauftrag, aber ohne Krone und stehendes Heer. Goethe verabscheute die Französische Revolution, weil sie sein den Künsten gewidmetes Herzogtum bedrohte. Er verehrte Napoleon, weil er es verschonte. Für den nationalen Überschwang der Befreiungskriege hatte er nur Hohn und Spott übrig. Weimar war es aber auch, wo Herder die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit vollendete, sein Hauptwerk, in dem er den landschaftlichen Charakter eines Lebensraums zur Ursache für den »genius« eines VOLKES erklärt – und nicht, wie Montesquieu, der ähnlich, aber politisch dachte, für den »esprit« seiner Gesetze und Institutionen.
Die Universitätsstadt Jena steht dagegen für die praktische Romantisierung des Politischen, die Bewegung des Nationalismus. Als die dortige »Urburschenschaft« im Oktober 1817 zum Nationalfest auf die Wartburg bei Eisenach rief, waren Datum und Ort mit Bedacht gewählt. Vier Jahre nach der Völkerschlacht bei Leipzig sollten sich Studenten aus allen deutschen Ländern zum 300jährigen Jubiläum der Reformation dort versammeln, wo Martin Luther die Bibel übersetzt hatte. Deutsche Sprache, deutsche Landschaft, deutsche Geschichte und eine anti-universalistische Auslegung des Christentums bildeten die kulturelle Kulisse, vor der sich die Nation politisch formierte. Dabei standen die Einheitsfarben Schwarz-Rot-Gold, in die sich die Jenenser Studenten kleideten, in demonstrativem Kontrast zur Route ihrer zweitägigen Wanderung: Um in den anderen Landesteil nach Eisenach zu gelangen, mussten sie einen Zipfel Preußen und das Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha durchqueren. Einer der Fahnenträger war der spätere Historiker und Hegelverächter Heinrich Leo. Gebürtig im benachbarten Schwarzburg-Rudolstadt, dessen Fürsten seine Laufbahn nach Kräften förderten, studierte mein Vorfahr damals in Jena, wo er zu den Gründungsmitgliedern der Urburschenschaft gehörte.
Das heraufziehende Zeitalter der Nationen, und insbesondere den 1871 gegründeten preußisch-deutschen Nationalstaat, sollte später Friedrich Nietzsche, hier näher an Goethe als an Herder, als eine Europäisierung der Kleinstaaterei verspotten. Was hätte er erst zu den Nazis gesagt und zur Lächerlichkeit einer politischen Romantik, die nur den Exzess der Gewalt kannte, nicht aber die Kunst der Politik. Die keinen neuen Staat schuf, kein Imperium und keine Institution, sondern nur ein Höllenreich der Lager. Es nimmt sich ja wie ein diabolischer Reim auf den deutschen Nationalismus aus, dass im KZ auf dem Ettersberg, wo man einen guten Ausblick auf die Kulturstadt Weimar hat, die meisten Insassen politische Häftlinge waren.
Das etwas südlicher gelegene Rudolstadt, aus dem Heinrich Leo und auch mein nach ihm benannter Urgroßvater stammten, habe ich nie betreten. Die Landschaft meiner Vorfahren gehört nicht zu mir. Fasziniert, aber orientierungslos zeigte ich sie meinem Freund wie ein Tourist im eigenen Land. Auf der Rückfahrt kamen wir vom Weg ab. Die Navigationsapp wies ihn uns – von Buchenwald zum Regenbogen. Auf die Autobahn. Zurück nach Berlin, wo der eine Leo, vom deutschen Nationalisten zum preußischen Patrioten bekehrt, während der Einigungskriege Mitglied im Herrenhaus war, und der andere, vom post-ironischen Münchener zum deutschen Patrioten gewandelt, heute lebt.
*
Hat diese Ideenspannung nicht auch die Geschichte von Israel-Palästina geprägt? Denn ist nicht auch der Zionismus eines ihrer Kinder? Für Herder verkörperte das Judentum den Urtyp eines nationalen Volksgeistes. Und in der Gleichgültigkeit gegenüber dem Politischen klangen Theodor Herzls Projekt einer »jüdischen Heimstatt« und seine Utopie einer weltbürgerlichen Kolonie namens »Altneuland« wie ein Echo der Weimarer Kulturmission. Dagegen stand der real existierende Zionismus von Beginn an im Zeichen der politischen Romantik. Der Staat Israel besitzt ja auch deshalb bis heute keine festen Grenzen, weil er nie entschieden hat, wie sich sein völkerrechtlich anerkanntes Territorium zum »Land Israel« verhält, der mythischen Landschaft des Alten Testaments, die auch das Jordanland, Gaza und Teile Syriens umfasst. Während der sozialistisch-säkulare oder »praktische« Zionismus prinzipiell bereit war, die Waffenstillstandslinie von 1949 als Staatsgrenze zu akzeptieren, hat der revisionistische oder »politische« Flügel, aus dem der heute dominante Likud hervorgegangen ist, die »großisraelische« Ambition nie aufgeben. Der einen Strömung war die Ausdehnung in die seit 1967 besetzten Territorien zu wichtig, um sie nach der Machtübernahme 1977 nicht zu forcieren; der anderen war die Selbstbeschränkung nicht wichtig genug, um es in der Gebietsfrage zum inneren Konflikt kommen zu lassen.
Wofür aber steht der zweite Teil des Namens: Palästina? Für eine Region des »Orients«, die das »Abendland« seit den Kreuzzügen zur Projektionsfläche seines Anderen, und damit zu einem Fokus der eigenen Identität, gemacht hat? Für eine imperiale Verwaltungseinheit, die lange von den Osmanen und dann, in etwas anderen Grenzen, kurz und folgenreich von den Briten regiert worden war? Für einen jüdischen Sehnsuchtsort, das Ende der Diaspora und die Rettung vor den Nazis? Für die Wunde eines Erinnerungsraums, eine jäh zerstörte Gesellschaft aus arabischen Christen und Muslimen, dessen Bewohner heute zerstreut über die halbe Welt, in Israel und dem Nahen Osten, in Europa und Amerika leben? Für die besetzten, besiedelten, blockierten und umkämpften Gebiete, in denen das Volk der Palästinenser ein international anerkanntes, aber faktisch bestrittenes Recht auf SELBSTBESTIMMUNG besitzt: für Gaza, die einstige Perle des Nahen Ostens, die nach den Schlachten von 1917 nun ein zweites Mal dem Erdboden gleichgemacht wird, und das in drei Hoheitszonen zerstückelte Westjordanland, dessen Karte an das mitteldeutsche Puzzle der Goethezeit erinnert oder, wenn man die Verbindungsstraßen zwischen den jüdischen Siedlungen dazu nimmt, an die Lofoten?
So umstritten das Land mit dem vieldeutigen Doppelnamen aber auch sein mag – es hat eine geographische Umschreibung gefunden, die neutral genug ist, um für die meisten seiner Bewohner Sinn zu ergeben: vom Jordan bis zum Mittelmeer.
From the river to the sea.
Das ist die eine, die unverfängliche Antwort auf die Frage nach Bashirs Herkunft. Sie sagt eigentlich alles – und zugleich fast nichts. Es gibt aber noch eine andere Antwort, und die ist so eindeutig und konkret, dass sie auch am Anfang einer langen Geschichte stehen könnte. Ich komme, sagte Bashir, als wir uns etwas besser kennengelernt hatten, aus Sachnin.
Die kleine Stadt, deren Einwohner fast alle zur arabischen Minderheit gehören, liegt mitten in den Bergen Galiläas, etwa gleich weit entfernt vom See Genezareth und dem Meer, von Nazareth und der Grenze zum Libanon. Weil sie seit Jahrhunderten bis in den letzten Winkel der christlichen Welt hallen, sind uns die Namen der biblischen Orte vertraut. Man findet sie auf den historischen Landkarten des Neuen Testaments genauso selbstverständlich wie auf Google Maps. Doch in der Umgebung von Sachnin gibt es noch andere historische Ortsnamen, die keine frohe Botschaft bezeugen, sondern einen Kampf gegen das Vergessen. Namen wie Deir al-Qassi. Ein al-Zeitun. Al-Kabri. Teitaba. Von diesen und über 400 weiteren Dörfern, die in den Staatsgründungskriegen 1947/48 entvölkert und zerstört worden sind, stehen heute bestenfalls noch Ruinen. Der fast 650 Seiten starke Atlas, in dem der Historiker Walid Khalidi das Schicksal dieser Ortschaften rekonstruiert und ihren gegenwärtigen Zustand dokumentiert hat, trägt den Titel: All that Remains.
Alles, was geblieben ist.
(Was wird von Gaza bleiben?)
Alle erwähnten Namen, die aktuellen wie die versunkenen, finden sich auch auf einer Karte, die einem Epos dieser palästinensischen Landschaft vorangestellt ist: Elias Khourys Roman Bab al-Shams, dessen Erzählung zwischen der Gegenwart und der Katastrophe von 1948 oszilliert, während die Protagonisten – in einem endlosen Netz aus Geheimpfaden und Verstecken, aus kargen Erinnerungen und blühenden Geschichten – zwischen den libanesischen Lagerstädten und den Bergen Galiläas pendeln, den Orten der Herkunft und einem Exil, von dem niemand weiß, ob es je enden wird. Und auch hier gibt es keine klare Grenze. Israel und Libanon sind nur die Namen eines Zufalls, der darüber entschied, ob man als »palästinensischer Flüchtling« an der Peripherie Beiruts lebte und starb, oder als »48er« in einer Landschaft aus arabischen Dorfruinen und jüdischen Siedlungen, in Städten wie Haifa, Nazareth und Sachnin.
Elias Khoury war ein Freund von Bashir. Er starb am 15. September 2024 – dem Tag, an dem unsere gemeinsame Zeit am Wissenschaftskolleg begann.
Das Wappen von Sachnin zeigt einen Sonnenaufgang zwischen zwei Bergen.
Bab al-Shams bedeutet: Tor zur Sonne.
Ex oriente lux.
Aber auch Fußballexperten könnte der Name von Bashirs Heimatstadt etwas sagen. Als der FC Bnei Sachnin 2004 den israelischen Pokal gewann, hatte sich damit zum ersten Mal ein arabischer Club für den Uefa-Cup qualifiziert. In Europa war es eine Nachricht, aber in Galiäa brach das Fußballfieber aus. Wen werden wir als Gegner kriegen? Wohin wird es gehen? An den Polarkreis? Nach Georgien? Nach Stuttgart oder Bochum? Das Los fiel auf Newcastle United. Alan Shearer, Patrick Kluivert, Jean-Alain Boumsong – nicht schlecht. Wie aber kriegt man die größte Reisegruppe, die Sachnin je gesehen hat, heil nach Nordengland? So, wie man hier alles hinkriegt. Man bucht einen Flug nach London und überlässt den Rest einem Sohn der Stadt, der dort gerade zufällig studiert.
Es sind denkwürdige Szenen einer apokryphen Fußballgeschichte. Während der Tross aus Honoratioren, Familienmitgliedern und Fans die Hotelmanagerin an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt, weil alle Zimmertüren offenstehen und die Shishas ständig den Feueralarm auslösen, muss der angehende Wissenschaftler Bashir, den Kopf eigentlich voll mit Theoriedefiziten bei Habermas und Rawls, über Nacht einen Buskonvoi nach Newcastle organisieren. Und irgendwie klappt es. Im Hinspiel hat es schon eine 1:5-Klatsche gegeben, das Rückspiel läuft nicht viel besser. Dann nochmal sechs Stunden auf der Autobahn, nochmal kaum eine Minute Schlaf. Aber die Stimmung ist sensationell und das Abenteuer unvergessen.
Bashir lacht heute noch darüber.
Weniger lustig war die Reaktion der Ultras von Beitar Jerusalem. Stolz, dass noch nie ein Araber in ihrer Mannschaft gespielt hat, geben sie nach dem Pokalsieg von Sachnin eine Todesanzeige auf, gewidmet: dem Fußball Israels.
Die beiden Vereine stehen für gegensätzliche Entwürfe der israelischen Gesellschaft. Bnei Sachnin will ein »kultureller Regenbogen« sein, Beitar Jerusalem, benannt nach der Jugendbewegung des revisionistischen Zionismus, ein dezidiert jüdischer Club. Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern sind notorisch. Doch seit dem 7. Oktober hat den gesamten Ligabetrieb eine gereizte Stimmung erfasst. Als vor dem Auswärtsspiel bei Hapoel Beersheba – zu Ehren von sechs ermordeten Hamas-Geiseln – die israelische Nationalhymne gespielt wird, kehren die Sachnin-Fans dem Stadion demonstrativ den Rücken zu. Innerhalb weniger Minuten eskaliert die Lage, aufgebrachte Hapoel-Fans stürmen die Gästekurve, es kommt zu Prügeleien, Verletzten und Festnahmen.
Das Spiel findet nicht statt.
Würde man sich in Europa wirklich für Israel und die arabische Welt interessieren, hätte man wissen können, dass Ereignisse wie dieses zur Vorgeschichte der hässlichen Szenen gehörten, die im November 2024 die westliche Öffentlichkeit erschütterten. Am Vorabend des Europa-League-Spiels bei Ajax Amsterdam rissen Anhänger von Maccabi Tel Aviv Palästinafahnen von den Fenstern, riefen »Tod den Arabern« und sangen »In Gaza gibt es keine Schulen, weil es keine Kinder gibt«, woraufhin am nächsten Tag arabische Jugendliche ihrerseits wahllos Fans aus Israel attackierten. Doch die Übertragung eines mörderischen Konflikts in Praktiken der symbolischen GEWALT wurde bei uns nicht als das begriffen, was sie ist, sondern – wie so oft – nur zum Anlass genommen, das eigene Weltbild zu stabilisieren. Einhellig zeigten sich Politiker und Kommentatoren entsetzt über die »antisemitische Hetzjagd« von Amsterdam. Es dauerte Tage, bis ein jugendlicher Freizeitreporter und die New York Times die Ereignisse in ein differenzierteres Licht rückten.
Als ich Bashir beim Lunch auf die Sache ansprach, nannte er die Berichterstattung »a disgrace« – eine Schande. Die Empörung war berechtigt. Und doch war ich erstaunt, wie leicht ihm das starke Wort über die Lippen kam.
Und wie verächtlich er dabei guckte.
*
Mit den Ereignissen von Amsterdam hatte unser kollegial-freundschaftliches Gespräch ein Thema gefunden, auf das wir immer wieder zurückkommen sollten. Offensichtlich unterschieden sich unsere Haltungen zum Journalismus fundamental. Ich sah in Zeitungen, Radio, Fernsehen usw. das, was Medien dem Wortsinn nach sind: Instanzen der Vermittlung. Ein Forum für gute und schlechte Nachrichten, für diese und jene Meinungen. Ein Feld der Kommunikation, das prinzipiell allen offen steht. Auf ihm kann man fehlende Informationen beisteuern, falsche Behauptungen berichtigen, einseitigen Meinungen widersprechen. Und dann schaut man, ob der Anblick der Welt sich dabei nicht allmählich ein wenig verändert – und ob es einem gefällt. Wenn nicht, muss man halt wieder raus.
Alle, man: Die unpersönlichen Subjekte sagen viel über die Selbstverständlichkeit, mit der ich mich auf diesem Feld bewege. Wenn meine Meinung gefragt ist, meldet sich ein Journalist bei mir. Wenn ich etwas zu sagen habe, melde ich mich bei einem Journalisten. Wenn mir eine journalistische Plattform zu dumm wird, wechsle ich zu einer weniger dummen. Ich habe nichts gegen Journalisten, ich bin sogar mit einigen befreundet. Es handelt sich einfach um Kollegen, die schneller schreiben als man selbst, und nur hin und wieder, wenn man ein Buch veröffentlicht hat, für ein paar Wochen zu Kritikern, also potentiellen Feinden, werden.
Für Bashir dagegen, das wurde mir allmählich klar, gab es diese professionelle und persönliche Nähe nicht. Wo ich die voreilige Berichterstattung über Amsterdam für einen ärgerlichen, aber korrigierbaren Fehler hielt, schien er nur triste Normalität zu erkennen: keine Enttäuschung, sondern die Bestätigung eines tief sitzenden Misstrauens, das sich mal in Resignation ausdrückte, mal in Verachtung, und fast immer in Vorsicht.
Tatsächlich fiel auf, dass Bashir sich trotz vielfacher Aufforderungen nur zögerlich in die ÖFFENTLICHKEIT begab. Regelmäßig fragte er nach, ob bestimmte Personen oder Institutionen, die ihn zu einem Publikumsvortrag eingeladen hatten, uns vertrauenswürdig erschienen. Oft sagte er ab. Und über Journalisten, nicht nur die deutschen, sprach er, als hätte sich ein ganzer Berufsstand gegen ihn verschworen. Das einzige Interview, das er während seines Aufenthalts in Deutschland gab, wurde vom Wissenschaftskolleg organisiert. Weil ich ihm bei der deutschen Übersetzung half, weiß ich, wie minutiös er vor der Autorisierung jedes Detail redigierte. Dass er mit dem Resultat am Ende zufrieden war und die Resonanz – zunächst – sehr positiv ausfiel, teilte er uns mit wie ein Wunder.
Wie konnte es sein, dass derselbe Fellow, der im vertrauten Kreis so sicher auftrat, der mit seinem Wissen und seiner – nie polemischen – Schärfe die Diskussionen in unserem Colloquium prägte, dem das Spiel mit der Ironie genauso leicht fiel wie der Vortrag aus dem Stegreif, dessen Rede brannte, wenn er überzeugen wollte, und glühte, wenn er ein Gedicht vortrug, der genau wusste, wann es zu schweigen galt, und den wir darum ganz selbstverständlich zu unserem Sprecher gewählt hatten, so gereizt und schroff wirken konnte, so verletzlich, wenn er sich von einem Klischee getroffen, ja nur mitgemeint fühlte?
Es war klar, dass Bashir und ich zu einem kleinen Kreis von Fellows gehörten, die man – mit einem etwas aus der Mode gekommenen Wort – als Intellektuelle bezeichnen könnte. Womit gemeint ist, dass unser Schreiben und Denken sich nicht nur an ein Fachpublikum richtet, sei es das akademische oder das literarische, sondern auch an die politische Öffentlichkeit. Viel weniger klar aber war, was das im Einzelnen bedeutete. Für mich jedenfalls bedeutet es, dass ich mich in einem nationalstaatlich organisierten Netz aus Institutionen bewegen kann, in dem sich Meinung mehr oder weniger direkt, früher oder später, in Einfluss übersetzen lässt. Wer will, dass sich die Verhältnisse in Deutschland ändern, darf den Pulverdampf auf dem Schlachtfeld namens Öffentlichkeit nicht scheuen.
Und für Bashir? Es gibt keine kurze Antwort auf diese Frage. Aber es gibt einen Ausgangspunkt, ohne den jede Antwort ins Leere laufen muss. Bashir ist Palästinenser. Und das heißt: Er gehört zu einer Nation ohne STAAT.
*
Die palästinensische IDENTITÄT ist in vieler Hinsicht unspezifisch. Ihr religiöser Hintergrund ist muslimisch, christlich oder drusisch. Ihr Sprachraum ist arabisch, aber viele Schlüsselwerke zur palästinensischen Lage wurden auf Englisch publiziert. Intellektuelle Leitfiguren wie Edward Said oder Walid und Rashid Khalidi, zwei herausragende Vertreter der palästinensischen Historiographie, leben/lebten in den USA, wo auch das Journal for Palestine Studies erscheint, herausgegeben u.a. von der brillanten Historikerin Sherene Seikaly, die mit uns zusammen am Wiko war. So weit verstreut die Wohnorte der Palästinenser, so unterschiedlich sind die Bedingungen, unter denen sie leben. Said, Seikaly und die Cousins Khalidi gehören zur amerikanischen Bildungselite; die Bewohner des Westjordanlandes sind der Willkür von Soldaten, Siedlern und Geheimdiensten ausgesetzt, die des Gaza-Streifens aktuell sogar der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen; die Vertriebenen und ihre Nachfahren, die sich seit 1948 im Libanon oder in Gaza befinden, gelten weiterhin als staatenlose Flüchtlinge, aber auch in Ländern wie Deutschland ist ihr Status in mancher Hinsicht prekär; die Palästinenser in Jordanien genießen volle Rechtsgleichheit, fühlen sich dem Land aber oft nicht zugehörig, die in Israel leben besser als in den besetzten Gebieten, sind aber trotzdem vielfacher Diskriminierung ausgesetzt. Die Vorfahren dieser so unterschiedlichen Menschen konnten vor 1948 reiche Händler gewesen sein, Besitzer von Orangenplantagen, prächtigen Villen und sogar Sklaven – oder Tagelöhner; osmanische Würdenträger, britische Kolonialbeamte und haschemitische Diplomaten – oder Fellachen; hochgebildete Notabeln – oder Analphabeten.
All diese Lebenslagen haben jedoch einen gemeinsamen Fokus. Es gibt heute keine palästinensische Identität ohne Nationalbewusstsein. Gemäß Benedict Andersons berühmter Definition ist eine NATION eine vorgestellte Gemeinschaft, die Anspruch auf politische Selbstbestimmung erhebt. Nationen, deren Selbstbestimmungsrecht durch einen Staat verwirklicht ist, neigen jedoch mit der Zeit dazu, die politischen Voraussetzungen dieses Zustands zu vergessen. Bürger eines souveränen Nationalstaats können es sich erlauben, die eigene Existenz für individuell zu halten. Wer will, geht dann alle paar Jahre kurz zur Wahl, um sich ansonsten auf Familie und Beruf, Freizeit und Freunde, Glauben und Selbstverwirklichung zu konzentrieren.
Für Nationen, denen die Selbstbestimmung verwehrt wird, sei es durch ein imperiales Zentrum, eine Kolonialmacht oder ein Besatzungsregime, bleibt das Politische dagegen akut. Solche Nationen stehen vor der kategorischen Wahl, zu resignieren oder für ihre Rechte zu kämpfen. Dass die Palästinenser in diesem Sinne eine kämpfende, akut politische Nation sind, heißt nicht, dass über die Mittel und das Ziel ihres Kampfes Einigkeit herrschte, im Gegenteil: gewaltsam oder zivil, diplomatisch oder konfrontativ, Boykott oder Kooperation; panarabischer Superstaat, Souveränität über ganz Palästina, zweistaatlich neben Israel, autonom in Israel, föderal mit Israel, islamische Theokratie, levantinische Union – die strategischen Optionen waren und sind so zahlreich wie die Modelle der Selbstbestimmung. Es heißt nur, dass das Wissen um die vorenthaltene Freiheit sich so wenig vergessen lässt wie die eigene Muttersprache. Jeder Palästinenser will das Ende der israelischen Besatzung. Und in diesem Sinne gibt es keine palästinensische Identität, die nicht auf die eine oder andere Weise politisch wäre.
Man kann diese Dimension des Politischen passiv erfahren, wenn etwa die Existenz des eigenen Volkes immer wieder bestritten wird, während man, nur weil man ja zu diesem Volk gehört, permanent demütigenden Kontrollen, geheimdienstlicher Überwachung oder Bombardements mit einkalkulierten Kollateralschäden ausgesetzt ist (um von ignoranten Journalisten vorerst zu schweigen) – und darum immer wieder Wut, Verzweiflung, Trauer, Trotz, Verachtung und Hass empfindet. Man kann sie aber auch aktiv gestalten, indem man bei Tätigkeiten, die andere vermeintlich um ihrer selbst willen ausüben, das Politische nie aus den Augen verliert.
Besonders deutlich wird das in der Kunst und in der Wissenschaft.
Die palästinensische Literatur hat unzählige Meisterwerke hervorgebracht. Doch wenn etwa Ghassan Kanafani in Men in the Sun beschreibt, wie drei junge Männer auf der Flucht nach Kuwait in einem leeren Wassertank ersticken; oder in Return to Haifa, wie ein Ehepaar 1967 das Haus aufsucht, aus dem sie 1947 vertrieben wurden, nur um festzustellen, dass ihr im Trubel der Flucht verloren geglaubter Sohn von den Holocaustüberlebenden, die das Haus übernommen haben, großgezogen wurde und – anders als seine vier Eltern, die arabischen wie die jüdischen – zu einem überzeugten Zionisten geworden ist; wenn Emile Habibi in The Secret Life of Saeed die traurig-lächerliche Geschichte des »Pessoptimisten«, eines Palästinensers in Israel, als Parabel auf die Absurdität der menschlichen Existenz erzählt; wenn Mahmoud Darwish in einem großen Gedicht die Kunst des Wartens feiert und dabei unentscheidbar bleibt, ob er auf den menschlichen Liebesakt oder die Befreiung seines Volkes anspielt; wenn Wajdi Muoawad in dem Theaterstück The Birds den Zufall der biologischen Abstammung mit der Macht eines irrigen Herkunftsbewusstseins konfrontiert; oder in dem Roman Anima die Massaker, die christliche Milizen – gedeckt von der israelischen Armee – 1982 in den libanesischen Flüchtlingslagern Sabra und Shatila verübten, mit der marginalisierten Existenz der kanadischen Natives verwebt; wenn Adania Shibli in Minor Detail die Geschichte einer Vergewaltigung rekonstruiert, die ein israelischer Soldat 1948 an einer jungen Araberin begangen hat, während sich in der Rahmenhandlung die Recherchereise aus dem Westjordanland nach Israel wegen all der kleinen Schikanen wie eine Expedition ausnimmt: dann speist sich die literarische Energie dieser Werke aus dem Wissen um – und den Widerstand gegen – die palästinensische Lage, während ihre Größe darin besteht, sich der Anklage – wie der Parole – zu enthalten.
Auf seine Weise gilt das auch für die Forschung und das Denken palästinensischer Wissenschaftler. Es gilt für Edward Said, wenn er in Orientalism zeigt, wie der Westen das kulturell Andere braucht, um über sich selbst zu sprechen; und in Question of Palestine, wie Europa seine »jüdische Frage« nach Palästina ausgelagert hat, und was es bedeutet, seiner Rechte ausgerechnet von einer Gruppe beraubt zu werden, die selbst Opfer eines unsäglichen Verbrechens geworden ist. (Beide Bücher sind heute in gewisser Hinsicht überholt, aber zugleich als Ausgangspunkt für das Verständnis der Palästinenser unverzichtbar). Es gilt für Walid Khalidis historische Forschung, die auf Tausenden Seiten den Beweis erbringt, dass es die Palästinenser tatsächlich gibt, dass sie eine Geschichte haben, die nicht erst 1948 begann, und dass sich das Wissen um die Verluste nicht auslöschen lässt. Es gilt für Rashid Khalidis Studie Palestinian Identity, die den gleichen Zweck verfolgt und dabei präzise unterscheidet zwischen dem Exemplarischen und dem Spezifischen, also einem Nationalbewusstsein, das ebenso unvermeidlich konstruiert ist, wie es zugleich auf Erfahrungen basiert, die eben nur Palästinenser machen; und für sein The Hundred Years‘ War on Palestine, eine Gesamtdarstellung des Konflikts um Palästina, die den Zionismus – in kritischer Abgrenzung von dessen Selbsterzählung – als koloniale Siedlungsbewegung beschreibt. Es gilt für Sherene Seikalys Men of Capital, eine Geschichte der palästinensischen Gesellschaft in der Mandatszeit, die zeigt, wie der Versuch scheiterte, Palästina unter liberalen Auspizien in einen panarabischen Wirtschaftsraum zu integrieren.
Und es gilt natürlich auch für Bashir Bashirs Wissenschaft. Dabei griffe es zu kurz, ihn als Politologen zu bezeichnen. Politischer Theoretiker träfe es besser. Am besten aber trifft es wohl eine Umschreibung: Bashirs Denken sucht nach einer politischen Antwort auf die von Said so meisterhaft entfaltete Frage – the question of Palestine.
*
Man muss Tania Martini fast dankbar sein für einen Text, der alle Voraussetzungen für eine exemplarische Lektüre erfüllt (Prophetische Wissenschaft, F.A.Z. v. 27.7.25). Dabei geht es gar nicht um die Schärfe der Kritik. Es geht um ihre Begriffslosigkeit. Politisches Denken lässt sich natürlich kritisieren: sei es durch einen alternativen Begriff des Politischen oder auf Grundlage von empirischem Wissen. Fehlt jedoch beides, läuft die Kritik Gefahr, ihren Gegenstand vollständig zu verfehlen, was hier bedeutet: die moralische Hinrichtung eines Denkers, die weder dessen Position zur Kenntnis nimmt, noch sich in irgendeiner Weise zu dem von ihm thematisierten KONFLIKT verhält.
In Deutschland sind nach dem 7. Oktober unzählige Texte erschienen, die das Scheitern moralischer Intuition bezeugen, weil das Urteil sein Ziel schon erreicht hat, bevor das historische Interesse und die politische Neugier auch nur gestartet sind. Martinis Text ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme, aber insofern speziell, als er einen palästinensischen Denker entsorgt, der die deutsche Intuition auf eine grundsätzliche Weise irritieren muss. Hellwaches politisches Bewusstsein trifft hier auf ein Ressentiment, das nur moralisieren kann, weil ihm die Mittel zum Denken fehlen. Das Spektakel, das dabei entsteht, ist unschön. Und einen Text zu verfassen, in dem ohne Übertreibung kein einziger Satz stimmt, muss man erstmal schaffen. An vier Stellen zeigt sich die Ignoranz aber immerhin so deutlich, dass sie Anlass zur Aufklärung bietet.
Erstens, in grundsätzlicher Absicht.
»Wer vom Genozid an Palästinensern spricht wie Bashir Bashir«, heißt es am Ende von Martinis Artikel, »sollte vom palästinensischen Vernichtungsantisemitismus nicht schweigen. Aber das wäre wohl zu viel verlangt von jenem Aktivismus, der im deutschen Grunewald als Wissenschaft ausgegeben wird.«
Lassen wir es vorerst auf sich beruhen, dass hier die gut begründbare und damit diskursfähige These vom Genozid an die Bedingung geknüpft wird, sich einen Kampfbegriff wie »Vernichtungsantisemitismus« zu eigen zu machen. Schauen wir nur auf die Unterstellung, hier tarne sich Aktivismus als Wissenschaft.
Politisches Denken wird regelmäßig von Intellektuellen betrieben, die ein Anliegen verfolgen. Genauso regelmäßig fragen Medien Intellektuelle lieber nach ihren Anliegen als nach den theoretischen Grundlagen ihres Denkens. In Martinis Terminologie wird aus diesen simplen Tatsachen: Hier spricht ein Aktivist. Wo aber das Problem liegen soll, sagt sie nicht. Und wie auch? Es gibt keine POLITISCHE WISSENSCHAFT, die nicht einerseits von einem vorwissenschaftlichen Standpunkt ausginge und sich andererseits nicht in nachwissenschaftliche Aktivität übersetzen ließe. (Als das Fach in Deutschland noch so hieß, war es höchst lebendig – das Sammelsurium aus policy-Analysen, empirischer Meinungs- und Wahlforschung, Systemvergleichen und IB, also die real existierende Politikwissenschaft, ist dagegen trostlos.)
Wer wollte bestreiten, dass Edmund Burke gültige Einsichten über die Französische Revolution formuliert hat, oder Alexis de Tocqueville über die moderne Demokratie, oder Carl Schmitt über den liberalen Verfassungsstaat, oder Hannah Arendt über den Totalitarismus, oder Edward Said über den Zionismus, oder Judith Butler über die Ordnung der Geschlechter, oder Eric Hobsbawm über den Kapitalismus – obwohl sie ihren Gegenständen, gelinde gesagt, nicht zugeneigt waren und sich selbst vielfach politisch engagierten? Die Wissenschaft, der unabschließbare Prozess des begrifflichen Denkens und methodischen Forschens, fand in all diesen Fällen in einem Raum zwischen ideologischer Überzeugung und politischer Praxis statt. Das schränkte, verglichen etwa mit der theoretischen Physik, die Autonomie dieser Wissenschaft auf der einen Seite ein, bewahrte sie aber auf der anderen vor Willkür. Diese unvermeidliche Bedingtheit lässt sich von außen positional (»er ist Marxist«), von innen reflexiv (»ich bin Marxist«) bestimmen, gemeint ist aber das Gleiche. Der polemische Gegenbegriff zur politischen ist daher nicht die neutrale oder »wertfreie«, sondern die POLITISIERTE Wissenschaft, also eine Praxis des vermeintlichen Denkens und Forschens, die sich auf ideologische Doktrinen reduzieren lässt.
Bashir Bashir ist der Musterfall eines politischen Wissenschaftlers. Auf ihn trifft zu, was auch für alle genannten Denkerinnen und Denker gilt – sein Lebensthema ist nicht zu trennen von seiner Biographie. Fragt man nach einem konkreten Ausgangspunkt für die existentielle Dimension seines wissenschaftlichen Interesses, lautet auch hier die Antwort: Sachnin. Bashir kam in einer Stadt zur Welt, die noch unter Schock stand. Am 30. März 1976, zwei Wochen vor seiner Geburt, war es zum ersten Mal seit 1948 zu einer gewaltsamen Konfrontation zwischen der arabischen Bevölkerung und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Sechs Demonstranten wurden getötet, Hunderte verletzt, als 4.000 Polizisten und Einheiten der IDF einen Massenprotest niederschlugen, der sich gegen die israelische Bodenpolitik richtete.
Wie in jedem echten politischen Konflikt geht es auch zwischen jüdischen Israelis und den lokalen Palästinensern um Land und Kontrolle über den Raum. Um in Haifa zu arbeiten, war Bashirs Vater bis 1966 auf eine Genehmigung des Militärgouverneurs angewiesen. Und bis heute wird der palästinensischen Minderheit nur ein sehr eingeschränktes Recht auf Boden- und Immobilienbesitz zugestanden. Am deutlichsten aber zeigt sich der politische Kern des Konflikts in den israelischen Bestrebungen, arabisch geprägte Gebiete zu judaisieren. Das gilt offensichtlich für das Westjordanland und Ost-Jerusalem, es gilt aber auch für Galiläa. Als die Regierung Ende 1975 ankündigte, in der Nähe Sachnins – zugunsten der jüdischen Siedlungsstadt Karmiel – großflächige Enteignungen vorzunehmen, formierte sich eine regionale Protestbewegung, die in den blutigen Ereignissen vom 30. März kulminierte. Im palästinensischen Gedächtnis nimmt das Ereignis, an das heute am sogenannten Land Day erinnert wird, eine Schlüsselstellung ein. Und wenn das für die Palästinenser im Allgemeinen gilt, dann besonders für die in Galiläa.
Für meine Politisierung, sagt Bashir, spielten die alljährlichen Demonstrationen am Land Day eine ganz entscheidende Rolle.
Und worüber spricht er in dem Interview? Über die allgemeine Lage der Palästinenser. Er tut das aber nicht in Glaubenssätzen oder Parolen, sondern vor dem Hintergrund seiner Wissenschaft: mal deskriptiv, etwa wenn es um die Praktiken der Überwachung und Datenerfassung geht, denen eine Bevölkerung ohne Rechtsstaat schutzlos ausgesetzt ist; mal historiographisch, etwa wenn er von der Nakba, der palästinensischen Katastrophe von 1947/48, als einem Prozess spricht, dessen Charakter sich in der Unabgeschlossenheit des zionistischen Siedlungsprojekts zeigt; und mal theoretisch, etwa wenn er die Egalität des jüdischen und des arabischen Nationalismus zur unverhandelbaren Grundlage einer zukünftigen Ordnung erklärt. All das geschieht öffentlich und reflektiert. Er leugnet nicht, sich für ein Anliegen zu engagieren, und er nennt es auch beim Namen: Es ist ein Kampf. Aber das Mittel dieses Kampfes ist nicht die Waffe, sondern die Aufklärung. Und sein Gegenüber ist kein Feind, sondern eine Mauer aus Unwissen und Propaganda.
Bashir spricht daher auch nicht, wie Martini mit einem weiteren Kampfbegriff behauptet, als »Prophet«, also im Namen einer offenbarten Wahrheit, sondern als Vertreter eines eigenen Anliegens. Und als Teilnehmer am öffentlichen Diskurs. Er beantwortet Fragen. Und jeder Begriff, jede Grundannahme, jede These ist bestreitbar. Wer es unzutreffend findet, die Zerstörung aller materiellen und kulturellen Lebensgrundlagen in Gaza als »Genozid« zu bezeichnen, die Verhältnisse in den besetzten Gebieten und zunehmend auch in Israel als »jüdische Vorherrschaft« (im Original: Jewish supremacy), oder die wichtigste Voraussetzung für den Frieden als »Dekolonisierung«, der möge sagen, was daran falsch ist, und für die gleichen Sachverhalte andere Begriffe vorschlagen. Wer findet, dass der Teilungsplan der UN-Resolution 181 (II) von 1947, der – bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 1,2 Millionen Arabern und ca. 600.000 Juden – einen größeren jüdischen Staat (57% der Fläche) mit einer arabischen MINDERHEIT von 45% und einen kleineren arabischen Staat mit einer jüdischen Minderheit von 1% vorsah, ein für beide Seiten unwiderstehliches Angebot darstellte, der soll es aussprechen, statt in suggestiver Talking-point-Prosa Intransigenz zu unterstellen (»noch 1947 lehnten die Palästinenser den UN-Teilungsplan ab, der 43% der Gesamtfläche des britischen Mandatsgebiets für sie vorgesehen hätte«).
Zweitens.
In folgender Passage des Interviews erläutert Bashir, was er unter egalitärem Binationalismus versteht: »Er bietet den israelischen Juden das, was ihnen am meisten fehlt, nämlich Normalisierung und Legitimität in den Augen ihrer Opfer. Einzig die Palästinenser können den israelischen Juden diese Legitimität und Normalisierung auf eine Weise verschaffen, die wirklich tiefgehend und bedeutsam wäre.«
Martini kommentiert diese Passage so: »Dass Israel und der Zionismus illegitim sein sollen, behaupten mittlerweile nicht mehr nur islamistische Gruppen, die Mullahs, ultraorthodoxe Juden, der BDS oder rechte Extremisten. Auch in der Wissenschaft scheint diese Sicht angesichts israelischer Kriegsverbrechen zunehmend legitim zu werden.«
Wer hier keine Böswilligkeit unterstellen will, muss leider Ahnungslosigkeit konstatieren. LEGITIMITÄT bezeichnet ein nicht erzwingbares Verhältnis der Anerkennung, die es einem Gemeinwesen ermöglicht, in innerem und äußerem Frieden zu leben. Anders gesagt: Staaten, die sich mit ihren Nachbarn oder mit Teilen der eigenen Bevölkerung in einem Zustand des Konflikts befinden, genießen bestenfalls begrenzte Legitimität. Und genau das trifft auf Israel zu. Mit einem Teil der arabischen Staaten gibt es bis heuten keinen Friedensvertrag. Und zu seinem Herrschaftsgebiet gehören Territorien, die es seit 1967 rechtswidrig besetzt hält. Wenn aber die dort praktizierte Siedlungspolitik nach nahezu einhelliger Meinung der Völkerrechtler und des Internationalen Gerichtshofs ohne Rechtsgrundlage ist, dann soll ausgerechnet die Gruppe, die nach ebenso übereinstimmender Meinung einen rechtmäßigen Anspruch auf diese Gebiete besitzt und durch die jüdische Landnahme eine fortgesetzte Verdrängung erfährt, den Besatzerstaat für legitim erklären?
Wohlgemerkt, es geht hier nicht um den 1947 legalisierten Anspruch auf einen jüdischen Nationalstaat in Palästina. An diesem Punkt scheiden sich unter den Palästinensern tatsächlich die Geister. Aber eben das ist ja die Pointe eines »Binationalismus«, der das Selbstbestimmungsrecht zweier Nationen auf einem Gebiet prinzipiell anerkennt, während er die tatsächliche Anerkennung unter den Vorbehalt realisierter Gleichheit stellt. Es ist jedem Völkerrechtssubjekt freigestellt, den Staat Israel so, wie er ist, anzuerkennen. Und wem es Spaß macht, der darf das, ohne Rechtsfolgen, auch als Privatperson tun. Wer aber ein abstraktes Bekenntnis zum »Existenzrecht« Israels einfordert, ohne die konkreten Gründe zu würdigen, aus denen man einen Staat ohne feste Grenzen ablehnen kann, der hat, freundlich gesagt, ein fragwürdiges Verständnis von Völkerrecht und nicht den geringsten Begriff von Legitimität.
Drittens.
Martini stört sich daran, dass Bashir vom »globalen Palästina« spricht, während sie keine Notiz davon nimmt, dass er freundlicherweise auch erläutert, was damit gemeint ist. Nicht gemeint ist jedenfalls, wie sie glaubt, »das Fortschreiben einer binären Täter-Opfer-Erzählung, die als ideologisches Bindemittel dient und suggeriert, dass sich mit der Lösung des Israel-Palästina-Konflikts alle Konflikte der Welt lösen lassen. Sogar der Klimawandel.«
Weil mit der globalen Dimension ein zentraler Aspekt des palästinensischen Kampfes angesprochen ist, muss man hier etwas weiter ausholen. Denn nicht zuletzt macht dieser Aspekt auch verständlich, warum Bashirs Verhältnis zum Journalismus so sehr von Skepsis und Misstrauen geprägt ist.
Eine Nation ohne Staat hat in der Regel keine oder höchstens schwache Institutionen, in denen sie mit und über sich selbst kommunizieren kann. Deutsches Volk und deutsche Bevölkerung streiten, vermittelt über deutsche Journalisten, in deutschen Medien über Deutschland. Das Gleiche gilt für Frankreich, England, die USA oder Israel. Es betrifft aber nicht nur das nationale Selbstgespräch, sondern auch die internationalen Beziehungen. Wer sich in Deutschland über Bürger, politische Vertreter oder Angelegenheiten eines anderen Staates äußert, muss damit rechnen, dass dessen Botschafter protestiert, oder dass in dessen Öffentlichkeit die deutsche Öffentlichkeit zum Thema gemacht wird. Beides lässt sich am Beispiel Israels mustergültig zeigen. Der israelische Botschafter interveniert regelmäßig, wenn es um die Darstellung seines Landes geht; im Fall einer Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin griff sogar Premierminister Netanjahu höchstpersönlich ein. Und als – mit umgekehrter Tendenz – israelkritische Künstler und Wissenschaftler, darunter viele Israelis, in der deutschen Öffentlichkeit zum Gegenstand einer Kampagne gemacht wurden, wurde darüber in der israelischen Zeitung Haaretz berichtet, und zwar kritisch.
Weil – mit einem Wort – die REPRÄSENTATION von Nationen ohne Staat bestenfalls prekär ist, sehen sich die Palästinenser der Willkür nationalstaatlicher Öffentlichkeiten stärker ausgesetzt als die Staatsbürger anderer Nationen. Während sie heute weniger denn je über eine eigene nationale Öffentlichkeit verfügen, müssen sie permanent erfahren, dass im Westen über sie gesprochen wird, oft abfällig oder ignorant, und wohl nirgendwo so tendenziös wie in Deutschland. Hin und wieder wird aber auch mit ihnen gesprochen, und wenn sie Glück haben, sogar wohlwollend. Doch gegenüber Staatenlosen hat selbst das Wohlwollen seine Tücken. Wiederholt haben israelische Journalisten, die Bashir durchaus zugeneigt waren, ihn entgegen seiner ausdrücklichen Bitte nicht – wie unter seinesgleichen üblich – als »israelischen Palästinenser« oder »palästinensischen Staatsbürger Israels«, sondern – wie im nationalen Diskurs üblich – als »arabischen Israeli« bezeichnet. Der Unterschied mag einem gering vorkommen, weil er aber den Anspruch auf Selbstbezeichnung ignoriert, ist er in Wirklichkeit paradigmatisch. Es gibt Details, in denen steckt das Ganze. Als Bashir davon erzählte, kam es mir vor wie eine Urszene seiner Öffentlichkeitsscheu.
Ausgeliefert zu sein ist aber nicht gleichbedeutend mit Schutzlosigkeit. Auch die Belange einer Nation ohne Staat lassen sich öffentlich vertreten. Und im Fall der Palästinenser ist das auf dreifachem Weg geschehen: durch die Medien arabischer Staaten, durch Exilorganisationen und durch eine transnationale counter culture, zu Deutsch: Gegenöffentlichkeit. Die Gaza-Berichterstattung des qatarischen Senders Al-Jazeera wäre das naheliegende Beispiel für den ersten Weg. Wichtiger ist hier aber das komplementäre Verhältnis der beiden anderen.
In dem Wiko-Interview geht Bashir auch auf die historische Dimension der globalen Palästina-Bewegung ein. Eine transnationale Vernetzung von Akteuren, Organisationen, Diskursen und Symbolen im Namen der palästinensischen Sache, wie sie sich seit etwa zwei Jahrzehnten beobachten lässt, gab es nämlich in den 60er und 70er Jahren schon einmal. Dass Formen, Inhalte und Leitbegriffe damals von revolutionärer Militanz geprägt waren, während es heute um die gewaltlose Durchsetzung von Rechten geht, ändert nichts an einer strukturellen Ähnlichkeit der Bewegungen. Verstehen lässt sie sich aber am besten, wenn man auf Zwischenzeit schaut.
Warum spielte das »globale Palästina« in den 80er und 90er Jahren kaum eine Rolle? Erstens, weil mit der maoistischen Linken auch der politisch-kulturelle Hintergrund der Palästina-Solidarität zusammengebrochen war. Zweitens, weil die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), wie 1970 schon aus Jordanien, 1982 von der israelischen Armee aus dem Libanon vertrieben wurde und nach Tunis ins Exil ging, wodurch der globalen Bewegung ihr lokaler Resonanzkörper verloren ging. Drittens aber, und zentral für das Verständnis der gemeinten Komplementarität: weil sich die palästinensischen Exilorganisationen mit Beginn der ersten Intifada, und dank einer diplomatischen Initiative der US-Regierung, 1987/88 strategisch neu ausrichteten. Für gut zehn Jahre schien eine palästinensische Selbstverwaltung, und mittelfristig sogar ein souveräner Staat, tatsächlich greifbar. Während des sog. Friedensprozesses und durch die Einrichtung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) wurden die PLO und der Palästinensische Nationalrat (PNC) zu proto-staatlichen Institutionen. Erst als sich im Sommer 2000 die Idee einer trilateralen Verhandlungslösung endgültig als Illusion erwiesen hatte – wenig überraschend, wenn eine Organisation ohne Machtbasis und diplomatische Erfahrung zwei starken, eng befreundeten Staaten gegenübersitzt –, und kurz darauf die zweite Intifada ausbrach, bedurften die Palästinenser wieder der globalen Unterstützung.
Denn seitdem ist die palästinensische Lage durch zwei gegenläufige Tendenzen geprägt. Die lokale Situation in Israel, Gaza und dem Westjordanland lässt sich als orchestrierte ANOMIE beschreiben. Während der Kampf gegen die Besatzung wieder auf das rohe Mittel der terroristischen Gewalt zurückfiel, setzte das militärisch, ökonomisch, technologisch und geheimdienstlich überlegene Israel all seine Ressourcen ein, um den palästinensischen Nationalismus zu schwächen. Durch Grenzanlagen und Blockade vom israelischen Kernland abgeriegelt, ließen sich die palästinensischen Territorien voneinander entkoppeln und politisch spalten.
Im Westjordanland ist die von der Fatah dominierte PA faktisch ebenso abhängig von Israels Wohlwollen wie von internationalen Geldgebern. Weil unter diesen Bedingungen die Korruption blüht und eine Kooperation mit den israelischen Sicherheitsbehörden unvermeidbar ist, während gleichzeitig die jüdischen Siedlungen wachsen, besitzt die PA einen paradoxen Doppelstatus: International weiterhin als legitime Vertretung der Palästinenser angesehen, hat sie bei einem Großteil der eigenen Bevölkerung das Vertrauen verspielt. Auch deswegen hat es seit 2006 keine Wahlen mehr gegeben.
Bei der islamistischen Hamas verhält es sich genau umgekehrt. Seit dem innerpalästinensischen Bürgerkrieg von 2007 autoritäre Alleinherrscherin über den Gaza-Streifen – zumindest bis 2023 –, ist sie wegen ihrer terroristischen Militanz international geächtet, während sie als einzige Kraft des Widerstands gegen die israelische Besatzungs- und Blockadepolitik bei vielen Palästinensern eine gewisse Legitimität genießt. Und bis zum Massaker des 7. Oktober besaß auch die Hamas einen paradoxen Doppelstatus: Von Iran und Qatar finanziert, um Israel in Schach zu halten, wurde sie hinter den Kulissen auch von der israelischen Regierung unterstützt, um in einem klassischen divide-et-impera-Spiel die Fatah zu schwächen. Doch seit dieses machiavellistische Gleichgewicht 2023 kollabiert ist, wird in Israel das Szenario von Annexion und Vertreibung nicht mehr nur für Gaza, wo die militärische Gewalt völkermörderische Züge angenommen hat, sondern auch für das Westjordanland offen diskutiert.
Parallel zu dieser zunehmend verzweifelten Situation »on the ground« lässt sich aber ein globales Ringen um Alternativen beobachten. Wie so oft, hat das Bewusstsein der Niederlage geistige Energien mobilisiert. Und einmal mehr war es Edward Said, der nach der Jahrtausendwende die palästinensische Frage in einer furiosen Artikelserie erhellte. Ebenso schonungslos gegen Israel und den Westen wie gegen das Versagen der eigenen Führung, ebnete er aus dem amerikanischen Exil heraus einem neuen Paradigma den Weg. Träumer nennen es: One-state solution, Pragmatiker: One-state reality.
Mit dem Scheitern des trilateralen Verhandlungsprozesses, der Spaltung der palästinensischen Nationalbewegung und dem Legitimationsverlust seiner repräsentativen Organe setzte sich das Bewusstsein durch, dass Israel durch die fortschreitende Integration der besetzten Gebiete irreversible Fakten geschaffen hat. Nur eine verschwindende Minderheit der Palästinenser glaubt heute noch an eine Zweistaatenlösung. Und so ist für die Vordenker der palästinensischen Sache das Ende der Besatzung auch längst nicht mehr gleichbedeutend mit der Teilung des Landes. Vielmehr liegt für sie der Fokus des Kampfes nun auf der Durchsetzung gleicher Rechte auf einem Territorium. Was das konkret bedeutet, ob etwa der Fokus eher auf individuellen oder auf nationalen Rechten liegen soll, und erst recht, wie sich all das realisieren ließe, ist hoch umstritten. Aber die Grundidee erscheint klar und gerecht genug, um im digitalen Zeitalter eine globale Gegenöffentlichkeit zu mobilisieren: Ende der militärischen Gewalt, Freiheit von Besatzung und Blockade, Dekolonisierung, Rechtsgleichheit – das können viele unterschreiben, nicht zuletzt eine wachsende Zahl von Juden, besonders der jüngeren Generation, vor allem in den USA.
Es trägt allerdings erheblich zur Verkomplizierung der palästinensischen Lage bei, dass sich mit der globalen Solidarität auch die pro-israelische Öffentlichkeitsarbeit – Selbstbezeichnung: Information (hasbara), Fremdbezeichnung: Propaganda – globalisiert hat. Vor dem Hintergrund einer Holocausterinnerung, die nach dem Kalten Krieg zu einem kulturellen Symbol des Westens geworden ist, hat sich dabei vor allem die Figur des »israelbezogenen Antisemitismus« als äußerst wirkmächtig erwiesen. Den Erfolg dieser Öffentlichkeitsarbeit kann man exemplarisch an der Kampagne gegen die Bewegung Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) ablesen. Mittlerweile ist diese in allen Staaten des Westens offiziell – in Deutschland kraft Bundestagsresolution – als »antisemitisch« geächtet. Kaum noch ein Palästinenser bekennt sich daher öffentlich zur Boykottbewegung, während es zugleich fast keinen gibt, der nicht wenigstens indirekt, über Bekannte oder Freunde, mit ihr verbunden ist. Und wie auch immer sie BDS im Detail beurteilen (viele durchaus kritisch) – die Klage über westliche Doppelmoral ist allgegenwärtig: Leistet man mit Waffengewalt Widerstand, wird man als »Terrorist« geächtet, tut man es mit dem zivilen, freiwilligen und basisdemokratischen Mittel des Boykotts, als »Antisemit« diffamiert (weil es angeblich darum geht, den jüdischen Staat zu zerstören).
Doch Kampagnen sind ohnehin nicht Bashirs Sache. Ausgehend von Israel, wo ihn eine langjährige Arbeitsgemeinschaft mit dem Holocaustforscher Amos Goldberg verbindet, entfaltet er seine politische Energie vornehmlich in einem Netzwerk, das Wissenschaftler, Intellektuelle, Schriftsteller, Völkerrechtler und Menschenrechtsaktivisten aus aller Welt verbindet. Man trifft sich, um unterhalb des Radars der Öffentlichkeit, jenseits der diplomatischen Illusion, geleitet von einer Ethik der Versöhnung, die Lage der Palästinenser in all ihren Aspekten – politisch, theoretisch, juristisch, historisch und, nicht zuletzt, ästhetisch – zu diskutieren. London, Wien und Jerusalem sind die Zentren dieses menschlich ebenso lebhaften wie geistig anregenden Milieus. Es hat aber auch einen Ableger in Berlin. Und dank des Wiko ist er im vergangenen Jahr gewachsen.
Viertens, und letztens.
Bashir sagt: »[S]obald Israelis eine palästinensische Flagge sehen, Arabisch hören oder auf irgendein Zeichen palästinensischer Identität stoßen, ist dies selbst für die liberalen unter ihnen ein Moment der Störung.«
Viel prägnanter kann man den Kern des Konflikts kaum erfassen.
Martini quittiert diese Passage so: »Aber warum – um nur ein kleines unter vielen, aber umso triftigeres Beispiel zu nennen, das solcherart Verallgemeinerung Lügen straft – haben dann unter anderem so viele Kibbuz-Bewohner soziale und medizinische Projekte für Palästinenser angeschoben, bevor sie zum Dank dafür von der Hamas überfallen wurden?«
Viel prägnanter kann man den Kern des Konflikts kaum verfehlen.
Was Bashir anspricht, ist eine Identität, deren bloße Sichtbarkeit politische Bedeutung hat. Denn jeder kulturelle Ausdruck, den sie findet, sei es durch die Sprache, die Flagge oder die Kufiya, erinnert die Israelis daran, dass es auf dem von ihrem Staat beherrschten Territorium eine Gruppe gibt, die mehr sein will als eine »Minderheit« oder eine »Zivilbevölkerung«. Die Wahrnehmung der Palästinenser als Palästinenser ist in jüdisch-israelischen Augen eine unvermeidliche Irritation, auf die man irgendwie reagieren muss.
Man kann versuchen, sie gewaltsam zu unterdrücken, wie etwa in der ersten Intifada oder gegenwärtig bei Demonstrationen im israelischen Kernland. Man kann versuchen, sie auszulöschen, indem man die Realität hinter den Symbolen zerstört, vertreibt oder tötet. Man kann versuchen, sie zu verdrängen, indem man jedes Lösungsszenario für unrealistisch erklärt, die Mauern und Absperrungen als Sichtschutz betrachtet und lieber fernsieht als Haaretz zu lesen. Man kann versuchen, sie zu rationalisieren, indem man behauptet, zum Frieden bereit zu sein, nur habe die palästinensische Seite leider »noch jedes Angebot ausgeschlagen« bzw. leider »keine Verhandlungspartner« zu bieten, weshalb man sich gezwungen sehe, den Konflikt zu »managen« statt ihn zu lösen. Man kann versuchen, sie zu romantisieren, indem man Hummus und Olivenöl ostentativ bei einem arabischen Händler kauft. Man kann sie aber auch zu einer Gewissenssache machen, indem man vor der palästinensischen Lage, insbesondere in den besetzten bzw. blockierten Gebieten, nicht die Augen verschließt und irgendwie zu helfen versucht.
Und anders als die anderen Reaktionen ist diese Haltung bewundernswert, weil sie aller Gewalt zum Trotz an einem geteilten Horizont festhält – selbst nach dem 7. Oktober. Die menschliche Größe, mit der einige Bewohner der überfallenen Kibbuzim Anteil am Leid in Gaza nehmen und ein Ende der Kampfhandlungen fordern, kann einem tatsächlich die Sprache verschlagen. Keine Friedensinitiative, die auf allen Seiten mobilisieren will, wird zukünftig auf die ethische Substanz eines Zionismus verzichten können, der ja viel mehr war und ist als nur eine Siedlungsbewegung und ein Nationalismus. (Es ist eine höchst spannende Frage, wo sich der humanistische Überschuss auf palästinensischer Seite am deutlichsten zeigt; meine Vermutung: in der Literatur).
Hier aber ist entscheidend, dass die einzige israelische Reaktion, die aus Sicht der Palästinenser angemessen wäre, in der Anerkennung ihres Selbstbestimmungsrechts bestünde. Doch so lebendig auf israelischer Seite die Gewalt, die Verdrängung, die Rationalisierung, die Romantik und das Gewissen sind, so tot ist – von wenigen bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen – das Bewusstsein für die politische Dimension des Konflikts. Dass dieser entscheidende Aspekt nicht gesehen wird, gehört von jeher zur Erfahrung der Kolonisierten.
Gewalt oder humanitäre Hilfe – tertium non datur.
Das war aber nicht immer so.
Und darum kann es sich auch wieder ändern.
Die palästinensische Seite war nach einem schmerzhaften Lernprozess – von der Katastrophe 1948, über die Niederlage von 1967 bis zur Krise der Exilorganisationen nach 1982 – bereit, einen jüdischen Nationalstaat in Palästina zu akzeptieren. Die PLO hat Israel 1988 programmatisch, 1993 diplomatisch anerkannt (was seit 2018 suspendiert ist). Umgekehrt jedoch gilt das nicht. Was die Regierung Rabin den Palästinensern in den Oslo-Verträgen zugestanden hat, war ein Recht auf Repräsentation und lokale Selbstverwaltung, während das Recht auf nationale Selbstbestimmung an Voraussetzungen geknüpft wurde, deren Kontrolle faktisch in israelischer Hand blieb. Weil das Projekt der Zweistaatlichkeit in Israel zu keinem Zeitpunkt eine politische Mehrheit besaß, gab es auch keine einzige Regierung, die es je ernsthaft, also über Lippenbekenntnisse und unrealisierbare Ad-hoc-Pläne hinaus, wirklich verfolgt hätte. Während sich in den besetzten Gebieten die israelische Infrastruktur immer weiter ausdehnte, wurde der talking point einer »verhandelten Zweistaatenlösung« als diplomatisches Alibi für die westliche Öffentlichkeit gepflegt.
Dennoch kann man die Tatsache kaum überschätzen, dass sich für etwa ein Jahrzehnt ein großer Teil der israelischen Gesellschaft ein Ende des Konflikts und ein Zusammenleben mit den Palästinensern vorstellen konnte, ja sogar wünschte. Man kann jedoch auch kaum überschätzen, dass es damals zwar einen geteilten Horizont gab, aber – jenseits der Pressekonferenzen – keinen gemeinsamen Leitbegriff. Auf israelischer Seite lautete das Ziel der Wohlmeinenden: Frieden – also Ruhe, Normalität und Abwesenheit von Gewalt. Auf palästinensischer Seite lautete es: Freiheit – also ein Ende der Besatzung und politische Selbstbestimmung.
Wer diese Ungleichheit der Ziele übersieht, kann auch nicht begreifen, was das endgültige Scheitern des diplomatischen Prozesses für die Konfliktparteien jeweils bedeutete. Als im Juli 2000 die Verhandlungen zwischen Bill Clinton, Ehud Barak und Yasir Arafat unter gegenseitigen Schuldzuweisungen ergebnislos endeten, brach für beide Seiten der geteilte Horizont zusammen. Doch was für die Israelis das Ende des Friedensprozesses war, lief für die Palästinenser auf die Endlosigkeit der Besatzung hinaus. Anders als zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Libanon, gab es im Konflikt mit den Palästinensern ja weder Waffenstillstandslinien noch Grenzen, hinter die sich beide Seiten hätten zurückziehen können. Es gab nur unterschiedliche Territorien unter einer de facto ungeteilten Souveränität. Und so wechselte mit dem Scheitern der Diplomatie der Konflikt wieder das Register. Wo die palästinensischen Nationalsymbole zuvor die Möglichkeit einer zweiten Souveränität repräsentierten, wurden sie nun wieder zu dem, was sie bis zur Annäherung zwischen Rabin und der PLO gewesen waren: ein Zeichen des Widerstands gegen die Besatzung.
Halbzeitstand: Vier zu null für Sachnin.
*
Als Bashir und ich einen Tag nach dem Ende unseres Wiko-Jahres nach Weimar fuhren, war Tania Martinis Artikel noch nicht erschienen, der von Patrick Bahners hingegen schon (Hamas sei mehr als das, F.A.Z. v. 9.7.25). Während wir auf der regnerischen Rückfahrt, erschöpft von den Eindrücken eines langen Tages, über das Wetter und private Dinge sprachen oder einfach schwiegen, hatte auf der Hinfahrt – bevor wir uns erfreulichen Gegenständen wie der Musikalität des Luthertums widmeten – Bahners‘ Text noch bleischwer in der Luft gehangen. Wir diskutierten ausführlich über ihn, weil sich auch eine Woche nach seinem Erscheinen einfach nicht vergessen ließ, was da Schwarz auf Weiß geschrieben stand.
Und Patrick Bahners ist ein anderes Kaliber als Tania Martini.
Ich kenne in meinem intellektuellen Umfeld niemanden, der seine Artikel nicht ähnlich gespannt erwartet wie früher das allwöchentliche YPS-Heft. Wo Bahners draufsteht, ist immer ein Gimmick drin. Der Mann ist eine singuläre Erscheinung in einer singulären Kulturinstitution – dem Feuilleton der F.A.Z. –, und einige Zeitungsleser, darunter auch ich, würden sogar sagen, dass wir in Deutschland derzeit keinen besseren Journalisten haben.
Schön und gut, würde Bashir entgegnen, aber Journalist bleibt Journalist.
Natürlich empörte ihn der Bericht über den Vortrag, den er im Rahmen der Mosse-Lectures an der Humboldt-Universität gehalten hatte; aber er überraschte ihn auch nicht. Mich hingegen empörte er nicht nur – ich war vor allem enttäuscht. Und auch hier ging es weniger um eine kritische Sicht auf Bashirs Denken. Wir diskutierten oft kontrovers miteinander. Die Enttäuschung lag darin, dass Bahners sein ganzes Können einsetzte, ich würde sogar sagen: missbrauchte, um alle Voraussetzungen für eine echte Diskussion zu zerstören. Und so galt auch Bashirs Empörung nicht dem Tenor des Artikels, sondern der krassen Verzerrung seines Vortrags. Bahners‘ sprichwörtliche Spitzfindigkeit hatte sich hier zu einer Rabulistik gesteigert, die alle Subtilität des Arguments in einem Gespinst aus Feinsinn erstickte und unter einem Geröllsturz aus Böswilligkeit begrub. Doch weil er dabei am Ende einen wichtigen Punkt ansprach, vielleicht sogar den wichtigsten überhaupt, lohnt sich auch hier die Mühe der Kritik. Und anders als im Fall seiner Kollegin macht die Auseinandersetzung mit Bahners trotz allem irgendwie immer Spaß.
Packen wir also Schaufel und Pinzette aus.
»Wie sind im oben zitierten Satz die Unterdrückungstechnologie des Nebensatzes und die Nobelpreisträger und Dichter des Hauptsatzes verbunden? Bezeichnet wird die Konjunktion ›as‹, oben vorläufig mit ›während‹ übersetzt, ein tragisches Nebeneinander, oder träfe ›indem‹ das Gemeinte besser? Der Inhalt des Vortrags und der durchgehend anklagende Ton lassen kaum Raum für Zweifel: Ein Regime der Unterdrückung und des fortgesetzten Völkermords ist in Bashirs Augen der politische Rahmen, der die kulturellen Leistungen Israels möglich gemacht hat.«
Welcher Journalist außer Patrick Bahners würde es fertigbringen, in einem gerade mal eine Spalte langen Text eine selbstreferentielle Passage wie diese unterzubringen? Sie bezieht sich auf folgende Sätze aus Bashirs frei gehaltenem Vortrag, die in dem Artikel so zitiert werden:
»Der Zionismus hat das moderne jüdische Leben mit Erfolg revolutioniert. Er hat viele Argumente in die Welt gebracht, unter anderem das Argument, dass das jüdische Leben sich normalisieren werde, wenn man die Juden wie andere Völker behandele. Aber während der Zionismus eine raffinierte Technologie der Unterdrückung und der ethnischen Säuberung geschaffen hat, ist es ihm auch gelungen, raffinierte Institutionen, Wissenschaft zu schaffen, Nobelpreisträger und unglaubliche Hervorbringungen von Literatur und Dichtung, viel, das gefeiert werden kann. Jedoch ist der Zionismus jämmerlich daran gescheitert, Normalisierung und Legitimität in den Augen seiner Opfer zu erreichen.«
Ich war bei der Veranstaltung nicht anwesend. Da es sich aber, wie Bashir mir bestätigte, um denselben Vortrag handelte, den er auch zweimal in meiner Anwesenheit gehalten hatte, bin ich mit ihm vertraut genug, um den philologischen Fehdehandschuh aufzugreifen.
Das versteckt Tendenziöse zeigt sich hier wie die Stimmung in einer Ouvertüre. Denn als Meister des Details weiß Bahners natürlich, welche Tonart angeschlagen ist, wenn man »refined« mit »raffiniert« übersetzt. Bei den Überwachungstechnologien mag das Moment des Verschlagenen noch angehen. Aber im Kontext von Wissenschaft und Kultur wird es sinnentstellend. Bashirs Kritik der israelischen Macht ist genauso unzweideutig wie seine Anerkennung der israelischen Leistungen. Sie sind nicht »raffiniert«, sondern »hoch entwickelt« und darin durchaus bewundernswert.
Für seine Verhältnisse erstaunlich unveredelt ist dagegen die Widersprüchlichkeit, mit der Bahners einen Verdacht aufgreift, den der Philosoph und Arendt-Forscher Thomas Meyer hinsichtlich der erwähnten Nobelpreise nach dem Vortrag geäußert hatte:
»Meyer hörte hier eines der ältesten antisemitischen Klischees heraus, das Gerücht vom intelligenten Juden. ›So dürfen wir nicht sprechen‹. Nun ist das Zählen israelischer Nobelpreisträger vielleicht eher bei den Lobrednern des Staates Israel verbreitet. Das Problematische von Bashirs Bilanz des Zionismus mit den Nobelpreisträgern als Aktivposten kann man abgelöst von der Frage erörtern, ob seine Wortwahl eine der Antisemitismusdefinitionen erfüllt, deren Sinn und Unsinn das Thema der vierten und letzten Mosse Vorlesung von Shaul Magid aus Harvard sein wird.«
Unerwähnt bleibt allerdings Bashirs Widerrede, die immerhin so überzeugend ausfiel, dass Meyer den Punkt auf sich beruhen ließ. Es tut aber auch nichts zur Sache. Denn Bahners selbst weist ja darauf hin, dass die Lobredner Israels genau das Gleiche sagen. Nur den zwingenden Schluss, nämlich dass – will man die Absurdität eines israelfreundlichen Antisemitismus ausschließen – der Verdacht jeder Grundlage entbehrt, zieht er nicht. Im Gegenteil, Bahners selbst verleiht der Unterstellung Gewicht, indem er ihre Berechtigung weiterer Prüfung anheimstellt. Ich kann es nicht beurteilen, aber der Arendt-Forscher Meyer hat gesagt, überlassen wir also das Urteil den Experten… – exakt so funktioniert die Logik des Gerüchts. Nur gilt es hier nicht, wie haltlos behauptet, dem Juden, sondern, wie sich belegen lässt, dem vermeintlichen Antisemiten.
Tatsächlich raffiniert ist dagegen die Unredlichkeit, mit der Bahners die zitierte Passage interpretiert. Welche Bedeutung auch immer man nämlich der Konjunktion »as« gibt, die neben dem parallelisierenden »während« genannte Möglichkeit einer instrumentellen Kausalität gibt das Wort unter keinen Umständen her. »Indem« wäre im Englischen »by«, während »as« im Sinne von »weil« sich nur auf die Frage »warum?«, nicht aber die Frage »wodurch?« beziehen kann. Eben diese, eine unvermittelte Kausalität bezeichnende Übersetzung wäre aber nun nicht mehr deutungsbedürftig. Sie folgt zwingend entweder aus dem Kontext (»as you broke your leg, you can’t run«) oder der Wortwahl (»because«). Kurzum, alle kausalen Bedeutungen sind hier ausgeschlossen; es kann also um nicht mehr und nicht weniger gehen als die nüchterne Feststellung einer gemischten Bilanz: Der Staat Israel hat Bemerkenswertes geleistet – und zugleich hat er ein Unterdrückungsregime etabliert.
Wie sich nun diese beiden Befunde zueinander verhalten, ist für Bashir in der Tat eine zentrale Frage. Man könnte also einfach die Antwort zur Kenntnis nehmen, die er selbst gibt. Dieser so erfolgreiche Staat, so lautet sie, kann seine Leistungen nicht genießen, weil die Hälfte aller Menschen, über die er herrscht, ihm sowohl die Legitimität abspricht als auch die Normalität einer friedlichen Existenz verweigert. Davon war bereits die Rede. Doch ohne theoretischen Hintergrund wird man die Tiefe des Arguments nicht begreifen. Bahners scheint das immerhin zu ahnen, weswegen er auch das Buch erwähnt, das Bashir weltweit bekannt gemacht hat: die Anthologie The Holocaust and the Nakba. A New Grammar of Trauma and History. Bezeichnenderweise hat dieses Buch aber zwei Herausgeber, deren fast hundertseitige Einleitung heute als ein klassischer Text zur Deutung des israelisch-palästinensischen Konflikts gilt: den israelischen Palästinenser Bashir Bashir und den jüdischen Israeli Amos Goldberg.
Bahners schreibt: »Bashir rattert die Fügung ›the Holocaust and the Nakba‹ herunter wie ein Mantra. Sein Projekt verstößt gegen das Vergleichstabu, das Michael Rothberg, sein Mitkollegiat im Grunewald, untersucht. Doch das eigentlich Anstößige ist die strikte Asymmetrie des Axioms seiner Grammatik: Jüdische Israelis sollen die Schuld auf sich nehmen, die angeblich nur wegen ihrer Staatsangehörigkeit auf ihnen lastet – aber ein reziprokes Bekenntnis von palästinensischer Seite dürfen sie nicht erwarten.«
Schenken wir Bahners, dass es ein solches Tabu zumindest in der Wissenschaft nicht geben kann, da sich ja ohne Vergleich weder die Einzigartigkeit des Holocaust konstatieren ließe, noch jene Aspekte bestimmen, in denen er Ähnlichkeiten mit anderen Völkermorden aufweist. Schenken wir ihm außerdem, dass unser Mitkollegiat Michael Rothberg daher auch nicht das Verbot, sondern, im Gegenteil, die ubiquitäre Praxis des Holocaustvergleichs untersucht (um sinnvolle von unsinnigen zu unterscheiden). Weniger lässlich ist allerdings die Suggestion, Bashir und Goldberg verglichen überhaupt zwei historische Ereignisse miteinander. Sie tun es nicht. Sogar ausdrücklich nicht. Sie vergleichen überhaupt nichts miteinander. Und sie können es auch gar nicht, weil sie nämlich den israelisch-palästinensischen Konflikt als eine Beziehung begreifen. Die Formulierung ist so allgemein, dass sie entweder trivial bleibt – oder die Frage nach der Struktur dieser Beziehung erzwingt. Und hier liefert Bahners nun mit genialischer Intuition zwei Schlüsselbegriffe, auch wenn er ihren Sinn spektakulär verfehlt.
Sie lauten: ASYMMETRIE und REZIPROZITÄT.
Nur: Reziprozität ist ein Prinzip, Symmetrie ist eine Eigenschaft.
Ausgehend von der Verstrickung zweier Traumata fordern Goldberg und Bashir die Überwindung einer ideologischen »Grammatik«, durch die sich zwei unversöhnliche Narrative wechselseitig stabilisieren. Die jüdische Seite deutet ihren Anspruch auf Palästina ebenso hermetisch vor dem Hintergrund des Holocaust wie die palästinensische Seite den ihren vor dem Hintergrund der Nakba, also einer Staatsgründung, die nur zum Preis ihrer Vertreibung möglich war (die Tagebücher Ben-Gurions sprechen in dieser Hinsicht eine eindeutige Sprache). Diese geradezu mustergültige Tragik – zwei unschuldige Motive verstricken sich in eine gemeinsame Schuld – konfrontieren die beiden mit einer »neuen Grammatik«, die es ermöglichen soll, die imaginären durch reale Beziehungen zu ersetzen. Auf der individuellen Ebene läuft das auf eine Ethik der Empathie hinaus, und damit die Forderung einer reziproken, also wechselseitigen, Bereitschaft zur Beunruhigung (»unsettlement«) der eigenen Gewissheit. Wie die tragische Verstrickung der Traumata ist auch das ethische Postulat zu ihrer Überwindung strikt symmetrisch. Und das gilt auch für das politische Prinzip, das die beiden dazu als Orientierungspunkt anbieten: den egalitären Binationalismus.
Der Witz ist aber, dass sich diese politische Dimension auch positional vertreten lässt, und genau das tut Bashir in seinem Vortrag, indem er das Verhältnis der beiden Konfliktparteien aus palästinensischer Perspektive thematisiert. Solange sie um sich selbst weiß, ist diese, wenn man so will: strategische Einseitigkeit nicht nur vertretbar, sondern sogar unverzichtbar. Denn erst die an einen Standpunkt gebundene historisch-politische Analyse kann ja erhellen, dass das Gebot zur symmetrischen Reziprozität leer bleibt, ja ins Ideologische kippt, wenn es die Asymmetrie der realen Verhältnisse ignoriert. Der Konflikt zweier Nationalbewegungen entspricht der Gleichheit des Selbstbestimmungsrechts; und wenn man es abstrakt betrachtet, auch die des auf beiden Seiten schuldlos-schuldig erlittenen Leids. Konkret betrachtet, hat dieser Konflikt in den letzten 100 Jahren aber eine immer weiter anwachsende Ungleichheit etabliert: durch den Prozess der – legalen wie illegalen – Landnahme seit der Jahrhundertwende die zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten; seit 1948 die von staatlichem und staatenlosem Kollektiv; seit 1967 die von Besatzungsmacht und Zivilbevölkerung; seit 1987 die von Gewaltmonopol und Aufständischen; seit 1994 die von Terrorismus (in Israel) und Apartheid (in den besetzten Gebieten); seit 2006 die von selbstgebastelten Raketen und Luftkrieg; seit 2023 die von Massaker und Genozid usw. Man kann die Genese dieser Asymmetrien völlig moralfrei beschreiben, etwa in der Sprache des Tragischen, um die erschütternde Eindeutigkeit ihrer Bilanz anzuerkennen: Dem Zugewinn an Land, Institutionen, Souveränität, Wohlstand, Wissen, Infrastruktur, Nobelpreisträgern, kurz: an Macht auf der einen Seite stehen entsprechende Verluste auf der anderen gegenüber, ganz zu schweigen von einem Vielfachen an Menschenleben, Entwürdigung und Leid.
Wer das nicht sieht, muss ein Argument verfehlen, dessen ethische Forderung von Egalität und Reziprozität die realistische Anerkennung von Asymmetrie zur Voraussetzung hat. Dass beide Parteien um des Friedens willen einander etwas geben müssen, ist trivial. Dass es sich dabei um unterschiedliche Güter handelt, ist es nicht. Gemäß der Machtverteilung liegt der eine Schlüssel zum Frieden in israelischer Hand. Israel muss das strukturelle Unrecht, das der Zionismus für die Palästinenser bedeutet, anerkennen, symbolische und materielle Wiedergutmachung leisten sowie die Besatzung beenden. Gemäß der gleichen Machtverteilung liegt aber der andere Schlüssel zur Verwirklichung der großen Hoffnung, die der Zionismus für die Juden bedeutet, in der Hand der machtlosen Palästinenser. Den Staat Israel hat die PLO schon 1993 anerkannt; das Leid des Holocaust haben palästinensische Mitglieder der Knesset wiederholt gewürdigt. Weil aber die reziproken Gesten und Taten auf israelischer Seite nach wie vor ausstehen, hat die palästinensische Seite ihre Anerkennungen vorerst suspendiert. Nach dem Scheitern der Bilateralität steht sie unter dem Vorbehalt der Dekolonisierung – womit nicht die Abwicklung jüdischer Selbstbestimmung gemeint ist, sondern der Abbau jüdischer Privilegien, das Ende der Besatzung und ein Wandel der israelischen Mentalität. Solange diese Ziele, so der Schluss, nicht erreicht sind, wird die palästinensische Agenda auf die eine oder andere – besser oder schlechter zu rechtfertigende – Weise auf Widerstand hinauslaufen.
Man muss diesem Argument nicht zustimmen, um es denkend nachzuvollziehen, seine Eleganz zu würdigen und vor allem sein Ziel zu bejahen: die Auflösung einer tragischen Verstrickung und die Wiederherstellung des geteilten Horizonts. Aus palästinensischer Perspektive kann das sinnvollerweise nur bedeuten, erstens Realität und Legitimität eines jüdischen Selbstbestimmungsrechts prinzipiell anzuerkennen. Und zweitens, den Kampf gegen die Illegitimität der israelischen Besatzung fortzusetzen. Aber wie? An dieser palästinensische Schlüsselfrage scheiden sich die Geister. Bashir und die Hamas verkörpern hier gegensätzliche, ja unversöhnliche Antworten. Zu Zeiten der PLO hieß die legitime Alternative zum Terrorismus aber noch: bilaterale Verhandlungen mit Israel. Heute dagegen heißt sie: globaler Druck auf Israel.
Dass ethische Reziprozität die Anerkennung von politischer Asymmetrie voraussetzt, ist tatsächlich ein komplexes Argument. Was man angesichts eines tragischen Konflikts dennoch erwarten, ja verlangen kann, ist die für beide Seiten geltende Akzeptanz eines parteiischen Standpunkts. Der Kern des Problems, das die Palästinenser speziell in Deutschland haben, liegt nämlich nicht in der offenen Einseitigkeit, mit der etwa die Erzeugnisse des Hauses Springer sich – mit oft unverhohlen rassistischer Tendenz – pro-israelisch positionieren. Er liegt im einseitig formulierten Gebot, sich in einem Konflikt, in dem beide Seiten gute Gründe reklamieren können, ausgewogen zu positionieren. Denn für die Parteigänger Israels gilt es ja ganz offensichtlich nicht. Kein Mensch käme auf die Idee, die Deutsch-Israelische Gesellschaft für illegitim zu halten. Lobbyorganisationen gehören zur Demokratie, weswegen man sich an ihren Positionen stören kann, aber nicht an ihrer Existenz. Dass die palästinensische Seite von dieser Billigkeit stillschweigend ausgenommen wird, zeigt sich mustergültig in den beiden Artikeln.
Wer vom Genozid an den Palästinensern spreche, schreibt Martini, dürfe vom palästinensischen Vernichtungsantisemitismus nicht schweigen. Ja, warum eigentlich nicht? Soll denn auch vom Genozid an den Palästinensern nicht schweigen, wer vom palästinensischen Vernichtungsantisemitismus spricht? Die Einseitigkeit des Ausgewogenheitsgebots springt hier förmlich ins Auge. Aber bei Bahners ist es letztlich nicht anders. Wenn Bashir die Nationalbewegung der Palästinenser als das legitime Subjekt ihrer »agency« bezeichnet, dann quittiert Bahners das mit einer Ergänzung, die der Aussage all ihre politische Qualität nimmt: »Er sprach aber nicht aus, dass die wirksamsten Handlungen dieser Bewegung Akte des Terrorismus waren und sind.« Warum aber hätte er das tun sollen? Bashir hat gute Gründe, in der Nation den Hauptträger palästinensischer Rechte zu sehen, weswegen er gar nicht anders kann, als in der Etablierung dieses politischen Subjekts die folgenreichste Tat der PLO zu sehen. Und warum muss ein erklärter Antipode der Hamas sein nachweisbar unzweideutiges Verhältnis zur Gewalt als Bekenntnis formulieren?
Man kennt natürlich die Antwort. Doch anscheinend muss man sie ausbuchstabieren: In einem Staat, der die Solidarität mit Israel zur Doktrin erhoben hat, gibt es nur zwei legitime Positionen. Man kann offen für Israel sein und das auch sagen, wie etwa Außenminister Wadephul, der Deutschlands Position unumwunden als »parteiisch« bezeichnete, oder es zeigen, indem man, wie derzeit vor zahllosen öffentlichen Gebäuden, die Israelfahne hisst (zumindest bis in die ersten, düsteren Augusttage hinein, als wieder einmal die humanitäre Notlage die Regeln des Politischen suspendierte). Oder man kann eine Ausgewogenheit fordern, die wegen der ungleich verteilten Sprecherpositionen und asymmetrischer Machtverhältnisse bestenfalls gleichbedeutend mit einer versteckten Parteinahme für Israel ist. Schlimmstenfalls aber läuft das Neutralitätsgebot auf eine zynische Entpolitisierung hinaus, die darin besteht, in einem tragischen Konflikt beiden Seiten gute Gründe zu attestieren, aber nur einer Seite das Recht zum Kampf. Die Journalistin Hanin Majadli hat diese Asymmetrie in Haaretz kürzlich so umschrieben: »Ein Palästinenser kann keine politische Identität haben, ohne dass er als Terrorist wahrgenommen würde, während der israelische Besatzer in der einen Hand eine Waffe tragen darf und in der anderen ein Mikrofon, ohne dass jemand ihm das Recht absprechen würde, seine Geschichte zu erzählen.«
Erstaunlich ist dabei nicht, dass deutsche Politiker sich in der Sackgasse ihrer »Staatsräson« den Kopf wundstoßen. Erstaunlich ist auch nicht, dass eine Journalistin, die wie Tania Martini einen »antideutschen« oder »israelsolidarischen« Hintergrund hat, ihre Sicht auf die palästinensische Seite nur als passiv-aggressiven Double Bind formulieren kann. Erstaunlich ist, dass ein so kluger Journalist wie Patrick Bahners es nicht bemerkt.
Aber weiten wir den Blick, über Deutschland hinaus. Dorthin, wo die Musik des politischen Denkens spielt.
In den Nahen Osten und die USA.
*
Es gehört zu den faszinierendsten Aspekten der gegenwärtigen Lage, dass jüdische Intellektuelle mit israelkritischer Tendenz das Erbe des Revisionismus wiederentdeckt haben. Nachdem das Paradigma der Zweistaatlichkeit durch die irreversible Ausweitung Israels in die besetzten Gebiete obsolet scheint, ist nämlich eine klare Alternative zu erkennen: entweder Apartheid, Verdrängung und ultimativ Genozid – oder Zusammenleben auf einem Gebiet. Ob das individuelle oder nationale Rechtsgleichheit bedeutet, einen Staat für all seiner Bewohner oder getrennte Institutionen für zwei Nationen, eine Föderation auf dem ehemaligen Mandatsgebiet oder eine regionale Integration: All diese Fragen sind offen. Faszinierend aber ist, dass die schrittweise Realisierung Großisraels die Frage aufgeworfen hat, wie sich die Vertreter eines zionistischen Maximalismus einen solchen Staat vorstellten. Und die Antwort lautet: Die besten unter ihnen haben die Dinge zwar nicht zu Ende gedacht – aber das Problem haben sie gesehen.
Wenn zwei Völker in einem Staat leben, der für sich in Anspruch nimmt, eine DEMOKRATIE zu sein, müssen die Grundrechte all seiner Bürger geschützt sein. Genau das sah etwa der Plan vor, den der israelische Ministerpräsident Menachem Begin im Zuge des Friedensvertrags mit Ägypten formulierte. Dass er auch taktisch motiviert war und die Antwort unbefriedigend ausfiel, weil die politischen Rechte der arabischen Bevölkerung unberücksichtigt blieben, ändert nichts daran, dass der Horizont das Zusammenleben war, nicht Trennung oder Vertreibung. Und warum weiß ich überhaupt davon? Weil der israelische Philosoph Omri Boehm den Begin-Plan in seinem Buch Haifa Republic aufgreift, einer schonungslosen Abrechnung mit der Zweistaaten-Illusion, die jedoch darin Hoffnung stiftet, dass sie die zionistische Tradition auf Ideen zur Koexistenz mit den Palästinensern befragt.
Wenn dabei Figuren wie Martin Buber und der pazifistische Verband Brit Schalom ihren Auftritt haben, wird das niemanden verwundern. Überraschend hingegen ist, dass nicht nur Menachem Begin, sondern auch dessen Mentor Zeev Jabotinsky, der Gründungsvater der zionistischen Rechten, eine zentrale Rolle spielt. Aber es ergibt Sinn. So großisraelisch wie liberal orientiert, kam für Jabotinsky nämlich weder die Teilung des Landes, noch – zumindest bis kurz vor seinem Tod – die gewaltsame Homogenisierung seiner Bevölkerung in Frage. »Die Zukunft Palästinas«, so Jabotinsky, »muss, rechtlich gesprochen, auf einem ›binationalen Staat‹ begründet werden.« – Dieses Zitat ist dem dritten Kapitel des Buchs als Motto vorangestellt.
Boehm interpretiert Jabotinsky als rechtsliberalen Vordenker des Binationalismus. Vielleicht noch wichtiger aber war, dass der Politologe Ian Lustick – und auf dessen Spuren der Historiker Avi Shlaim – ihn als strategischen Denker wiederentdeckt hat.
Über die abstoßende Gestalt, die der Revisionismus in Form von Netanjahus Likud und die großisraelische Idee in Form messianischer Siedler angenommen haben, ist in Vergessenheit geraten, wie hellsichtig und früh Jabotinsky die politische Natur des jüdisch-arabischen Konflikts erkannt hat. In The Iron Wall, einem kurzen, harten, klaren Text, sprach er schon 1923 unmissverständlich aus, was heute jeder, der es sehen will, sehen muss: Eine koloniale Siedlerbewegung, die Anspruch auf ein bestimmtes Gebiet erhebt, wird auf die Gegenwehr der ansässigen Bevölkerung treffen. Also wird uns, so der Schluss, der bewaffnete Kampf nicht erspart bleiben. Jabotinsky wird heute zu Recht als der erste Theoretiker zionistischer Wehrhaftigkeit angesehen, und damit auch als Begründer der israelischen Sicherheitsdoktrin. Übersehen wird dabei allerdings, dass er durchaus kein Militarist war, sondern ein an Clausewitz geschulter politischer Denker. Denn was war das Ziel der »eisernen Mauer«, hinter der das fragile Siedlungsprojekt sich vor Gegenwehr schützen sollte? Einen Zustand zu erzwingen, in dem die arabische Seite ihren Widerstand aufgibt und bereit ist, mit den zionistischen Juden einen Modus des Zusammenlebens zu verhandeln.
Es ist Lusticks Verdienst, diesen militärisch-politischen Doppelhorizont rekonstruiert und damit Jabotinsky für die Gegenwart lesbar gemacht zu machen. Seine größte Leistung aber besteht in der Bereitschaft, mit Jabotinsky über ihn hinauszudenken. 1940 gestorben, hatte dieser nämlich nicht ahnen können, dass sich nach der Staatsgründung die Kräfteverhältnisse auf geradezu dramatische Weise umkehren sollten. Die einst wehrhafte Minderheit hat sich im Verlauf weniger Jahrzehnte in eine militärische Macht verwandelt, die – atomar bewaffnet und unter amerikanischer Patronage – nicht nur regional unangefochten ist, sondern auch auf dem ehemaligen Mandatsgebiet die einstige Mehrheit in jeder Hinsicht dominiert. Und so lautet die dialektische Einsicht: Weil in diesem asymmetrischen Konflikt die Parteien die Rollen vertauscht haben, ist es nie zu einem militärischen Patt gekommen, das die Ambitionen beider Seiten so nachhaltig frustriert hätte, dass politische Verhandlungen zielführend erschienen wären. In einer kühnen Volte deutet Lustick den aktuellen Zustand dahingehend, dass die Palästinenser sich heute in der gleichen Situation befinden wie vor hundert Jahren die zionistischen Juden. Sie sind es nun, die Israel durch ihren Kampfgeist zeigen müssen, dass sie sich weder beherrschen noch vertreiben lassen. Der Ausgang ist offen. Aber dass hier ein jüdischer Theoretiker mit einem Vordenker der zionistischen Rechten zu ähnlichen Schlüssen kommt wie ein palästinensischer Intellektueller im Schulterschluss mit seinem israelischen Freund und Kollegen – das motiviert zum Denken. Und es gibt Anlass zur Hoffnung.
Womit sich der Kreis zu Bashirs Herkunft geschlossen hätte. Denn wie lautet der Schlüsselsatz des Interviews, der ihm auch als Titel vorangestellt ist?
»Ich betrachte das ganze Land«
Betrachten wir ihn in seinem Land.
Stellt man den politischen Denker, nachdem sich der Nebel des Unpolitischen gelichtet hat, nämlich dahin, wo er herkommt, erscheinen seine Konturen nun viel klarer.
Wo befindet er sich?
Er steht in einer Landschaft.
Und er schwankt auf einem Feld.
*
Jede Nation konstituiert sich durch kollektive Selbstbehauptung. Findet diese jedoch nicht auf einem bestehenden Staatsgebiet statt, wie im Fall der französischen, die durch einen Sprechakt die monarchische Ständeversammlung in das Organ ihrer Selbstrepräsentation verwandelte, ist sie, das ist die Tragik Herders, unvermeidlich auf Romantik angewiesen. Weil sich Nationen ohne Staat nur im Widerstand behaupten können, sei es gegen den Zustand der Zersplitterung wie im Fall Italiens oder Deutschlands, gegen ein imperiales Zentrum wie im Fall der Nachfolgestaaten des Osmanischen und des Habsburgerreichs, gegen ein koloniales Mutterland wie im Fall der USA, oder gegen einen Siedlerkolonialismus ohne Mutterland wie im Fall der Palästinenser, können sie nur existieren, wenn sie eine dauerhafte Vorstellung von sich selbst entwickeln. Um ihre Ambitionen zu verwirklichen, brauchen sie die Kräfte der Imagination, des Glaubens, der Sinnlichkeit und der Erinnerung.
Wenn es ein schlagendes Beispiel für die politische Wirksamkeit dieser Kräfte gibt, ja für die Wunder, die sie vollbringen können, dann ist es der Zionismus. Ohne dessen Willenskraft und Standhaftigkeit gäbe es wiederum keinen palästinensischen Nationalismus. Doch das heißt nicht, dass er sich auf einen Anti-Zionismus reduzieren ließe. Die Bindung der palästinensischen Araber an ihr Land ist älter als die jüdische Siedlungsbewegung. Und so hat der Zionismus die palästinensische Identität auch nicht hervorgebracht. Wohl aber hat er sie politisiert. Und wenn es ein schlagendes Beispiel dafür gibt, dass diese Politisierung nicht nur auf Theorien und Ideen angewiesen ist, sondern auch auf die Vermittlung durch Natur und Kultur, dann ist es mein Freund aus dem merkwürdigen Land zwischen den beiden Wassern.
Als wir einmal die Bilder einer israelischen Porträtmalerin betrachteten, deren Kunst er sehr schätzte, stellte Bashir erstaunt fest, dass ihren Bildern der landschaftliche Hintergrund fehle. Mir kam es vor, als habe sich durch diese Bemerkung der Konflikt zweier Nationen plötzlich in die Komplementarität zweier Physiognomien verwandelt: hier eine kontextlose Sensibilität für das menschliche Antlitz, eine Anmut, die sich bis in die stofflichen und farblichen Nuancen des nackten Leibes hinein zeigte – dort der Magnetismus eines konkreten Raumes mit seinen kargen Bergen, seinen Wäldern, seinen Kräutern am Wegesrand, seinen uralten Olivenbäumen, seinem Fluss und seinem See, und natürlich seiner Sonne, die fast immer scheint, aber jeden Tag ein bisschen anders. Wer einmal ein Gläschen Zatar von Bashir geschenkt bekommen hat, eine von seiner Mutter zubereitete Mischung aus getrockneten Wildkräutern; wer gesehen hat, wie er sie mit Olivenöl mischt und dann einen Brocken Brot hineintunkt; wer sein köstliches Hummus gekostet hat; wer gehört hat, wie er von der Naturlyrik Mahmoud Darwishs spricht oder von Elias Khourys epischem Galiläa – der ahnt, dass hier eine politische Existenz nicht ihr Privatleben zeigte, sondern die Landschaft, aus der sie ihre Kraft zieht.
Die harte politische Sprache des Westens nennt diese Legitimität der Heimat »tellurisch«, also erdverbunden, und ihre Vertreter »Partisanen«, also Parteigänger. Doch zugleich verbirgt sie damit, dass in einem Zustand, in dem es überhaupt Partisanen gibt, auch die Gegenbegriffe, der gottähnliche Staat und die Legitimität seiner Armee, unrettbar parteiisch sind.
Bezeichnend für die Lage der Palästinenser ist jedoch, dass sie sich nicht nur in einem umkämpften Land behaupten müssen, sondern auch im politischen Kraftfeld einer Region. Es griff immer schon zu kurz, ihren Kampf auf die konkurrierenden Ansprüche zweier Nationen zu reduzieren. Und es war auch immer schon falsch, sich Israel als Insel in einem – wahlweise arabisch oder muslimisch genannten – Meer der Feindseligkeit vorzustellen. Tatsächlich hat es Israel auf der einen Seite mit einem staatenlosen Volk zu tun, das auf dem von ihm beherrschten Territorium legitime Rechte geltend macht, und auf der anderen mit Staaten, mit denen es wahlweise Krieg führen oder Frieden schließen kann. Die Palästinenser hingegen haben es auf der einen Seite mit einem jüdischen Nationalstaat zu tun, der sie nur als »Minderheit« oder »Zivilbevölkerung« duldet, während auf der anderen arabische »Bruderstaaten« stehen, die sich ihnen gegenüber von Anfang an ambivalent verhalten haben.
Solange die Arabische Liga noch im Zeichen der drei an Israel adressierten »Nos« – no peace, no negotiation, no recognition – agierte, war die ungelöste palästinensische Frage, und insbesondere das Schicksal der Flüchtlinge, ein politischer Hebel gegen einen Staat, den man wie einen Fremdkörper in der eigenen Welt als »zionistische Entität« bezeichnete. Seit sich jedoch für Israel dank amerikanischer Vermittlung – angefangen von Friedensverträgen mit Ägypten (1978) und Jordanien (1994), über die Abraham Accords mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko (2020), bis hin zu dem sich abzeichnenden Ausgleich mit Saudi-Arabien – der Weg bilateraler Beziehungen zu den arabischen Staaten immer weiter aufgetan hat, laufen die Palästinenser Gefahr, ohne regionale Schutzmacht dazustehen und im Schatten der Weltöffentlichkeit zu verkümmern. Gegen diese Übermacht der Staatsräson hat dem staatenlosen Volk letztlich immer wieder nur ein Mittel geholfen: Militanz. Sei es in legitimer Form wie in der ersten Intifada, oder in verwerflicher wie bei den Geiselnahmen der 70er Jahre, den Selbstmordattentaten in den Neunzigern, während der zweiten Intifada oder am 7. Oktober 2023 – dem globalen Aufflackern der politischen Aufmerksamkeit ging jedes Mal lokale Gewalt voraus.
Das Ziel des palästinensischen Terrors sind israelische Zivilisten. Sein Zweck aber ist die Provokation unverhältnismäßiger Gegengewalt, die wiederum die internationale Öffentlichkeit mobilisieren soll. Dass damit zunehmend nicht nur die Staaten des Westens, sondern auch des Nahen Ostens gemeint sind, liegt an dem Bedeutungszuwachs, den die dortigen Zivilgesellschaften im Zuge des Arabischen Frühlings erfahren haben. Doch aus Sicht der Palästinenser ist auch diese Entwicklung zwiespältig. Denn einerseits gab der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman kürzlich nur unumwunden zu, was nicht nur für ihn gilt: »Do I care personally about the Palestinian issue? I don’t. But my people do.« Auch autokratische Herrscher können die öffentliche Meinung nicht ignorieren. Andererseits haben die Demonstrationen im Zeichen arabischer und muslimischer Solidarität aus palästinensischer Sicht auch eine Kehrseite. Denn seit den demokratischen Revolutionen von 2010/11 regt sich unter arabischen Intellektuellen wieder verstärkt ein Gemeinschaftsgefühl, dem der Nationalismus der Palästinenser partikularistisch vorkommt, weil sie selbst in politischen und sozialen Kategorien eines Post-Panarabismus denken und das revolutionäre Erbe wachhalten wollen.
Fügt man noch hinzu, dass viele Palästinenser und auch die globale Palästina-Solidarität weiterhin anti-zionistisch denken, weswegen ein egalitärer Binationalismus, der auch das Selbstbestimmungsrecht der israelischen Juden bejaht, sie herausfordern und irritieren muss, dann ahnt man vielleicht, wie fragil Bashirs Position auf dem politischen Feld des Nahen Ostens ist. Betrachtet man das verwirrende Geflecht seiner Kraftlinien aber als Ganzes, erkennt man vielleicht auch noch etwas anderes: nämlich die immense Weite eines Blicks, der über die heimische Landschaft und die eigene Identität hinaus in die Welt schaut. Bashir hat die Geschichte Israels, Palästinas und des Nahen Ostens immer mit der Europas und des Westens zusammengedacht. Dass beispielsweise in unseren Gesellschaften gegenwärtig vor allem »Muslime« und »Araber« als Träger von Antisemitismus betrachtet werden, während man selbst sich einem pseudo-heroischen Schutz »der« Juden verschrieben hat, mutet ihm wie eine absurde Inversion der historischen Realität an. Denn die »arabische«, die »palästinensische« und die »muslimische« Frage haben ja alle den gleichen Ursprung. Sie entfalteten ihre komplexe und gewaltträchtige Dynamik erst, nachdem Europa mit seinen imperialen Ambitionen auch die »jüdische Frage«, also die Folgen des eigenen Antisemitismus, in den Nahen Osten getragen hatte.
Und schließlich erkennt man vor dem Hintergrund all dieser ungelösten, so tief miteinander verwobenen Fragen auch noch etwas anderes, nämlich die schwindelerregende Offenheit der Zukunft.
Und damit auch die Möglichkeit von Hoffnung.
*
Als Jordanien 1988 seinen Anspruch auf das Westjordanland und Ost-Jerusalem aufgab und diese Entscheidung im Friedensvertrag mit Israel 1994 besiegelte, hatte sich damit die vorerst letzte Tür für eine regionale Antwort auf die palästinensische Frage geschlossen. Die sogenannte »jordanische Lösung«, die das Flüchtlingsproblem bilateral gelöst hätte, war der natürliche Feind der PLO, weswegen sie zugleich der natürliche Freund Israels und amerikanischer Strategen wie Henry Kissinger war. Während aber die Integration der Palästinenser in das haschemitische Königreich auf ihre Entpolitisierung hinausgelaufen wäre, bestand die regionale Alternative in der Verzahnung des palästinensischen Widerstands mit dem arabischem Nationalismus. Die Tür dieser Möglichkeit, die den Erwartungshorizont lange dominierte, war jedoch schon mit der Niederlage von 1967 zugeschlagen. Seitdem hat sich der politische Horizont der Palästinenser immer weiter verengt. Und zugleich ist ihre Lage mittlerweile so verzweifelt und ihr Problem auf eine so brennende Weise akut, dass plötzlich alles denkbar erscheint.
Um es an den beiden Extremen festzumachen:
Pessimisten, die sich selbst bekanntlich gerne Realisten nennen, sehen nichts als einen Mahlstrom ungehemmter Gewalt, der das Schicksal der Palästinenser früher oder später besiegeln wird. In Gaza hat die Vernichtung bereits solche Ausmaße erreicht, dass, so die düstere Prognose, ein normales Leben dort für Jahrzehnte unmöglich ist und immer mehr Bewohner das Gebiet – dem zynischen Kalkül Israels folgend – »freiwillig« verlassen werden. Und im Westjordanland wird sich das palästinensische Leben unter dem Druck der Siedler, der Komplizenschaft des Militärs und dem politischen Willen der israelischen Mehrheit in immer kleinere Enklaven zurückziehen, bis es auch dort auch unerträglich geworden ist. Das andere Horrorszenario, ein Ausgreifen des wiederaufflammenden syrischen Bürgerkriegs auf das Westjordanland, ist damit noch nicht einmal erwähnt.
Und doch könnte es sein, dass derzeit eher die Optimisten den Realismus für sich beanspruchen dürfen. Die Zustände in Israel und Palästina sind so unhaltbar geworden, dass gerade, so die gegenläufige Prognose, ein bis vor kurzem noch undenkbarer Prozess begonnen hat. Europa hat sich von den USA entfremdet, während es auf die eine Weise mit dem Nahen Osten konvergiert, auf die andere mit dem globalen Süden. Die öffentliche Meinung, die im arabischen Raum immer schon auf Seiten der Palästinenser war, ist in den europäischen Staaten mittlerweile zu Ungunsten Israels gekippt; selbst in Deutschland bröckeln die Bastionen der Staatsräson. Und seit Staaten wie Südafrika und Nicaragua das Völkerrecht entdeckt haben, stellen sie uns vor ein Dilemma: entweder mit dem »demokratischen« Israel gegen das Völkerrecht – oder mit dem »westlichen« Universalismus gegen das Recht der Stärke. Es könnte tatsächlich sein, dass Großbritannien und die EU im Begriff sind, sich diesem doppelten Druck zu beugen und in eine politische Zweckgemeinschaft einzureihen, die Israel in die Schranken weisen, die Hamas entwaffnen und den Palästinensern zur Selbstbestimmung verhelfen will.
Wohin der Weg am Ende führen wird, weiß niemand. Aber dass sich unter dem Dach der UN kürzlich europäische Staats- und Regierungschefs mit arabischen Kollegen trafen, um über die politische Anerkennung Palästinas zu diskutieren, war vielleicht mehr als nur Symbolpolitik. Und mehr als ein Zufall war es vielleicht auch, dass zeitgleich in Foreign Affairs ein Artikel erschien, der die arabische Friedensinitiave von 2002 als »the most comprehensive and underutilized framework for resolution« bezeichnete. Saudi-Arabien und die Arabische Liga hatten damals vorgeschlagen, die israelische Anerkennung der palästinensischen Souveränität mit einer kollektiven Anerkennung Israels durch die Staaten des Nahen Ostens (außer Iran) zu verbinden. Und wer war der Autor des Artikels? Ami Ayalon, der ehemalige Chef des israelischen Innengeheimdienstes Shin Bet.
Weitet sich der Blick ins Historische, wird aus der Konvergenz eine Spiegelung.
Wie die palästinensische Frage den Nahen Osten in dauerhafte Unruhe versetzt hat, so konnte sich auch in Europa keine post-westfälische Friedensordnung etablieren, solange die »deutsche Frage« ungelöst war. Nach innen strebte der deutsche Nationalismus nach staatlicher Souveränität und Einheit. Nach außen aber waren damit Ambitionen verbunden, die sich durch politische Klugheit eine Weile »kleindeutsch« in Schach halten, aber am Ende nur durch zwei katastrophale Kriege entmutigen ließen. Der palästinensische Nationalismus könnte auf den ersten Blick gegensätzlicher nicht sein. Seine Ambition zielt nicht auf Dominanz, sondern auf das absolute Minimum einer selbstbestimmten Existenz. Und doch ist seine Befriedung ebenso das Schloss zu einer politischen Ordnung dort, wie es hier die Frustration des großdeutschen Nationalismus war.
Der Schlüssel aber liegt in der Hand Israels.
Und was ist Israel?
Israel ist das Scharnier, das Europa und den Nahen Osten verbindet, im Guten wie im Schlechten. Denn der Zionismus ist ja nur nicht ein Kind der aschkenasischen Kultur. Er ist auch ein Kind der antisemitischen Barbarei. Dass Europa und insbesondere Deutschland seine »jüdische Frage« zum Teil durch Massenmord »gelöst«, zum Teil durch die einseitige Unterstützung Israels auf Kosten der Palästinenser ausgelagert hat, gehört nicht zum europäischen Bewusstsein, und schon gar zum deutschen. Das sollte sich unbedingt ändern. Doch ein Land, das zwar eine Zeitung für sich selbst hat, aber kein Medium zur Selbsterkenntnis, ist dazu offenbar auf Unterstützung von außen angewiesen. Nun hat Palästina keinen Botschafter. Aber es hat einen Boten. Es hat Bashir. Und so könnte sein Besuch uns vielleicht helfen, endlich ein verdrängtes Erbteil der europäisch-deutschen Geschichte zu bergen.
Es täte, wie sich mit Goethe ahnen lässt, unserer Welt so gut wie seiner.
Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Occident!
Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände!