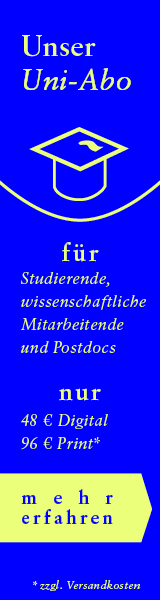Meine Erinnerung an Nikolaus Kuhnert
Wenn ich Nikolaus in den letzten Jahren besuchte, ging es viel um seine jüdische Herkunft. Er brach in Tränen aus, als ich ihn fragte, ob er sich mit Capers eine jüdische Frau gesucht habe, damit auch seine Kinder jüdisch seien. Mit den Tränen bracht er sein „Ja“ zum Ausdruck. Ich glaube nicht, dass Nikolaus gläubig war, aber er hatte ein archaisches Verhältnis zu seiner Herkunft. Seine Mutter hatte ihn nur mit einem Postausweis ohne Judenkennzeichnung 1939 in einer Klinik zur Welt bringen können, und er blieb Einzelkind. Halb versteckt überlebten beide dank des „arischen“ Vaters, der dafür aber auch zu einem Arbeitseinsatz zwangsverpflichtet wurde. Nikolaus hatte dunkle Phantasien, wie sein Vater, der – von Beruf Architekt – als Bauleiter auf einer Baustelle eingesetzt war, mit dem ihn unterstellten Zwangsarbeitern umgegangen sein mag. Bei meiner letzten Begegnung erzählte er mir, dass die Nachbarn seine Mutter festgebunden hatten, damit sie nicht wie versprochen zurück zur Synagoge in die Oranienburgerstraße ging, von wo ihr Vater am selben Tag deportiert wurde. So retteten die Nachbarn vermutlich das Leben der Mutter. Nikolaus‘ Großvater kam in Theresienstadt ums Leben. In tragischer Weise hatten Differenzen zwischen ihm und Nikolaus Vater verhindert, dass die Familie rechtzeitig gemeinsam in die Schweiz auswanderte. An all das hatte Nikolaus, 1939 geboren so gut wie keine bewusste Erinnerung, aber es hatte sich tief in sein Innerstes eingebrannt und wurde mit seinem Alt werden mehr und mehr präsent.
Ich lernte Nikolaus 1988, einige Jahre nach dem Tod seiner Mutter kennen. Er war von Aachen nach Berlin gezogen, um das frei gewordene Haus seiner Eltern in Berlin in der Zehlendorfer Bergengruenstraße 35 zu beziehen, dessen Grundstück sie durch „Wiedergutmachung“ erworben hatten. Ich war 24 Jahre alt, studierte an der TU Architektur und hatte mich auf ein Praktikum bei der Arch+ beworben. Daraus wurden fünf Jahre gemeinsamer Arbeit, die mich maßgeblich prägten. Nikolaus war mir wie stets jungen Menschen gegenüber neugierig und zugewandt. Ich selber hatte mein Studium eigentlich mit der Idee begonnen, praktizierender Architekt zu werden, wurde an der Uni aber nicht glücklich. Ich konnte das, was dort gelehrt und erwartet wurde, kaum zusammenbringen mit den Dingen, die mir wichtig waren. Meine Bewerbung bei Arch+ war eigentlich etwas abwegig, weil ich die Zeitschrift kaum kannte und auch sonst wenig theoretisch orientiert war. Aber mir war ihre Ausrichtung sympathisch, hatte ich mich doch vor meinem Studium in der Umwelt- und Friedensbewegung und bei den Grünen politisch engagiert – ähnliche Positionen fanden sich ja auch in der Arch+.
Fünf Jahre saßen wir uns tagein, tagaus im Souterrain des Hauses gegenüber, diskutierten, tranken Unmengen Kaffee aus French-Press-Kannen und rauchten Zigaretten auf der Terrasse im Garten, oder auch im Büro. Mittags ging es zum „Italiener“ am Mexikoplatz, der eigentlich ein Kroate war. Manchmal kam dann ein neuer Praktikant für einige Wochen oder Monate hinzu, dann waren wir zu Dritt. Es war eine andere Zeit, noch ohne Internet, Emails, Mobiltelefon und fast Computer-los. Zeitschriftenmachen bedurfte damals noch keiner Websites, Social Media und Events. Wir konnten uns ganz auf das Heftmachen fokussieren und widmeten uns alle drei Monate einem neuen Thema. Das etwas unregelmäßige Erscheinen machte immer wieder Ärger mit der Deutschen Post, die für „Postvertriebsstücke“ klare Vorgaben hatte. Aber ansonsten gab es nichts, was uns disziplinierte. Der Arch+ Verlag war selbstständig und lebte von der Hand in den Mund, aber die Verkäufe und einige Anzeigen reichten, um mit einer strukturellen Unterbudgetierung das Boot am Laufen zu halten.
Die Bergengruenstraße 35 in Zehlendorf war ein Kosmos für sich. Es gab kaum Kontakte zu etablierten Strukturen – seien es Berufs- und Fachverbände, Hochschulen, Museen oder Galerien. Nikolaus betrachtete die übliche Maschinerie des Architekturdiskurses mit Distanz und orientierte sich anderweitig. Der Blick ging nach Außen – Nikolaus interessierte sich für Politik, Philosophie, Literatur, bildende Kunst, Design. Und er blickte über den damals noch stark ausgeprägten deutschen Tellerrand – etwa nach Italien, Frankreich, Großbritannien und später in die USA.
Was ihn interessierte, waren Ideen und Konzepte. Wir haben kaum Architekturen gemeinsam angeschaut, aber unzählige Menschen getroffen und mit ihnen diskutiert. Er war neugierig und hielt stets Ausschau nach neuen Ideen und Positionen, mit einer besonderen Wertschätzung für abseitige Positionen. Dazu gehörten damals etwa Bruno Schindler, Manfred Schiedhelm, Fridtjof Schliephacke, Goerd Peschken, Joachim Krausse oder Hannes Meyer. Oder Figuren wie Klaus Heinrich und Vilém Flusser, die zwar in ihrem Bereich recht bekannt waren, aber außerhalb des üblichen Architekturdiskurses standen.
In Nikolaus‘ Kosmos bildeten einige Heroen Fixgestirne. Als ich ihn kennenlernte, war dies vor allem Otl Aicher und Richard Rogers. Und von früher Aldo Rossi und Oswald Matthias Ungers. Von meinem Interesse an Rem Koolhaas ließ er sich bald anstecken – er hatte ihn ohnehin schon zwei Jahre zuvor einmal interviewt. Wenn eine Person einen solchen Status erreicht hatte, war es ein „Full take“ – und Nikolaus identifizierte sich mit deren Gedankengut weitgehend. Verblüffend dabei war, dass diese Heroen – übrigens ausschließlich Männer – für sehr unterschiedliche, nicht zuletzt auch konträre Positionen standen, die Nikolaus dann in seinem Gedankenkosmos zusammenbrachte und in fast atemberaubender Weise miteinander verband.
Nikolaus besaß einen guten Riecher für relevante Themen und Positionen, die er dann mit großer Entschiedenheit verfolgte. Das prägte weitgehend das Profil von Arch+. In ganz anderer Weise war auch die Arbeit von seiner Kollegin Sabine Kraft in Aachen wesentlich für die Zeitung, aber für ihre andere Arbeitsweise hatte Nikolaus eine – wie ich fand – zu geringe Wertschätzung und das Verhältnis zwischen beiden war öfters angespannt. Nikolaus konnte in bemerkenswert stur sein, vermutlich eine Voraussetzung für seine gedankliche Autonomie, und um in seinen Kosmos durchzudringen, musste man manchmal eine erhebliche Schwelle überwinden. Keineswegs alles von Relevanz traf seinen Nerv. Die von mir initiierte Kolumne von Cedric Price wurde nach der ersten Nummer wieder abgeschafft, und mein Versuch, nach Delirious New York auch eine Übersetzung der Schriften von Bernard Tschumi auf den Weg zu bringen, verlief ins Leere, was aber wohl auch der wirtschaftlichen Fragilität des Verlags geschuldet war. Wegen dieser und ganz anderer blinden Flecken hatte ich mal gescherzt, eine Arch-minus zu gründen für alles, was in Arch+ keinen Platz hat.
Nikolaus war ein ‚homme de lettres‘. Aber er war auch stolz auf seine Mitarbeit im Büro von Hans Scharoun, wo er manche Fensterdetails für die Berliner Staatsbibliothek gezeichnet hatte, und seine beiden Scharoun‘esken Gebäudeentwürfe, die im Kontext des Büros seines Vaters entstanden waren. Besonderes Vergnügen bereitete ihm das Scribbeln des Heftlayouts, wo er mit Kuli im College-Block Seitenlayouts für das Heft grob vorskizzierte, d.h. eine visuelle Dramaturgie für das Heft als Vorgabe für die Gestalter entwarf. Wichtig war natürlich auch die Covergestaltung, die nicht immer den Grafikern überlassen wurde, sondern wofür wir auch mal Künstler wie Dieter Masuhr oder Martin Hoffmann beauftragten. Viel Mühe verwandten wir auf Bildersuche und Bildauswahlen. Bilder sollten den Text nicht illustrieren, sondern visuell ihre eigenen, konzeptuellen Geschichten erzählen.
In Nikolaus‘ College-Block sammelten sich die Notizen aus unseren Diskussionen, Gesprächen mit anderen und Ideen, die ihm zwischendurch kamen. Bemerkenswert war, dass er mich, der halb so alt war wir er und in vielem sehr unwissend, wie auch andere jungen Menschen als Gesprächspartner voll akzeptierte. Dabei waren wir öfters nicht einer Meinung, aber gerade dies mag er wert geschätzt haben. Im Nachgang erinnert mich sein Umgang an die Strategie Hannes Meyers, der den Dialog mit den Studierenden am Bauhaus suchte, weil er von ihnen eine Erneuerung des Denkens erhoffte. Und beim Zeitschriftenmachen mussten wir ja am Puls der Zeit bleiben. Auf Status und Formelles legte Nikolaus ohnehin keinen Wert.
Bei jedem Heft ging es darum, eine Position zu finden, eine These zu formulieren. Nicht immer gab es geeignete Autoren dafür, und für das Schreiben eigener Texte fehlte fast immer die Zeit. Der Ausweg bestand darin, Interviews zu führen, in denen wir Gesprächspartner mit unseren Fragen oder Thesen konfrontierten. Die Bearbeitung der Interviews und das Redigieren von Texten überlies Nikolaus weitgehend mir, während er sich vorbehielt, das Hefteditorial alleine zu formulieren, auch wenn es dann von uns beiden gezeichnet wurde. Ein Versuch einer gemeinsame Textarbeit war schon früh, beim Heft 100/101 gescheitert, als Nikolaus meine Bearbeitung seiner Textskizze rundum verwarf.
Im Sommer 1989 verfolgte Nikolaus gebannt die Nachrichten von der Deutschen Botschaft in Prag und den Entwicklungen in der DDR. Zu meinem Erstaunen war er recht aufgewühlt und saß stundenlang vorm Fernseher. Mir fehlte jeder Bezug zur DDR und die Teilung des Landes war für mich eine Konsequenz deutscher Geschichte, die ich als Gegebenheit hinnahm. Nikolaus aber war in Potsdam Babelsberg aufgewachsen und war erst 1953 mit seinen Eltern nach Westberlin geflohen, als die antisemitischen Exzesse im Ostblock zu Stalins Lebensende aufbrachen. Nach dem Mauerfall verbachten wir gemeinsam viel Zeit in Ostberlin und Leipzig, trafen Architekten und Künstler, unter anderem Helga Paris, die uns später im Zehlendorfer Büro auch fotografierte. Auch den Maler Konrad Knebel lernten wir kennen, von dem ich Bilder kaufte, die heute bei uns im Wohnzimmer hängen.
Nikolaus hatte nach seinem Schulabschluss eigentlich Bühnenbildner werden wollen. Aus jener Zeit war er mit dem Berliner Ensemble vertraut, wo er eigentlich eine Ausbildung absolvieren wollte, aber als Westberliner keine Chance hatte. Als wir an einem Winterabend 1989/90 auf der Suche nach einer Kneipe durch das damals weitgehend dunkle und tote Berlin-Mitte irrten, kam Nikolaus der rettende Einfall,in der Kantine des Berliner Ensembles einzukehren.
Etwas später lernte Nikolaus bei einem Abendessen bei Wolfgang Schivelbusch seine spätere Frau Capers kennen, die aus New York stammte. Es war eine Zeit, in der er selber versuchte, seinen jüdischen Wurzeln nachzugehen. An einer Magnettafel in der Küche hingen bunte hebräische Buchstaben, denn Nikolaus wollte etwas Hebräisch lernen, wozu es meines Wissens aber nie wirklich kam. In Folge seiner Bekanntschaft mit Capers reiste Nikolaus nun wiederholt in die USA und importierte von dort Diskurse, die mehrere Arch+ Ausgaben prägten. Eines von diesen hatte den Titel „Das amerikanische Zeitalter“, eine Bezeichnung, die auch autobiographisch zutraf. Mit Capers tauchte auch der erste Computer in unserem Büro auf, den wir dann mitbenutzten. Ich erinnere mich noch an ihr Wordperfect-Programm und die dünnen 8-Inches Floppy Disks.
Anfang 1992 starb mein eigener Vater. Die jüdischen Wurzeln meiner Familie, die Erfahrung von Widerstand, Verfolgung und Exil trugen zur Vertrautheit zwischen Nikolaus und mir bei. Auf manche hinterließen wir damals den Eindruck einer Vater-Sohn-Beziehung, und in gewisser Weise besetzen wir wechselseitig familiäre Fehlstellen. Nach dem Tod meines Vaters begann ich, seine Biografie zu recherchieren. Als ich später dann einen Aufsatz über den Massentransport der Untersuchungsgefangenen des Volksgerichthofs in der Endphase des NS-Regimes publizierte, fand Nikolaus mutig, dass ich meine Familiengeschichte outete. Dass mein Vater gemäß seiner eigenen Erzählung nach der Befreiung den verhörenden SS-Mann erschossen hatte, fand er genau richtig. Er war der Auffassung, dass in Deutschland 1945 einen Nacht der langen Messer gefehlt hätte, die es in Frankreich gegeben hätte. Er traute der deutschen Gesellschaft nicht und hatte Ängste, dass das Land schnell wieder in ein totalitäres Regime entgleiten kann.
Mit Skepsis verfolgte Nikolaus die deutsche Wiedervereinigung und so veröffentlichten wir Otl Aichers Plädoyer für eine getrennte Staatlichkeit. Die von Prinz Charles angezettelte Architekturkontroverse in Großbritannien hatten wir schon kritisch begleitet, als sich in Berlin mit der Wettbewerbsentscheidung zum Potsdamer Platz der identitär ausgerichtete Neotraditionalismus der Stimmann-Ära abzeichnete. Wir beauftragten Rudolf Stegers mit einer Kritik an der Metamorphose der Kollhoff‘schen Architektur, die in dem letzten Heft erschien, an dem ich als fester Redakteur beteiligt war.
Mit der Tätigkeit bei Arch+ hatte ich mein Studium nicht weiterverfolgt und zwischenzeitlich sogar erwogen, es ganz abzubrechen, benötigte ich doch keinen Abschluss für meine Arbeit. Als ich feststellte, dass ich auch mit begrenztem Aufwand ein Diplom erwerben konnte, entschied ich, dies nun endlich zu tun. Heft Nr. 117 im Sommer 1993 zu Rem Koolhaas war meine zunächst letzte Arch+-Ausgabe und nach meinem Diplom arbeitete ich zunächst anderthalb Jahre in dessen Rotterdamer Büro. Ich entschied mich gegen eine Rückkehr in die Redaktion, als mir die gewünschte Teilhabe an Verlag und Herausgeberschaft versagt wurde.
Ich ging meiner eigenen Wege, aber blieb aber Nikolaus, auch Sabine und der Zeitung verbunden, und war in manches Heft – vom Autor bis zur Gastredaktion – involviert. Zu meiner Verblüffung reagierte Nikolaus auf meine eigenen Arbeiten zuweilen mit Unverständnis und Ablehnung, sei es mein Erfahrungsbericht über die Arbeit bei Rem Koolhaas, sei es die Arbeit an Shrinking Cities oder meine Neubegründung der Zeitschrift Bauhaus. Bei Shrinking Cities fremdelte er wohl mit einer Arbeitsweise, die nicht von großen Theorien und heroischen Autorenschaften geprägt war, sondern sich zunächst dem Phänomen in einer breiten Recherche widmete. Entgegen all seiner Skepsis war dann aber das Arch+-Heft mit den Ergebnissen des Wettbewerbs, den Arch+ als Projektpartner durchführte, recht erfolgreich. Wertschätzung brachte er hingegen – so mein Eindruck – meinem politischen Aktivismus entgegen und war gemeinsam mit Anh-Linh solidarisch engagiert, als ich 2014 vom Dessau vom Hof gejagt wurde.
Wir trafen uns gelegentlich. Als an den Universitäten in Berlin und Stuttgart erste Historiografien über die Zeitschrift entstanden, war er erzürnt und sah diese als sehr verfälscht wahrgenommen und dargestellt an. Ich ermunterte ihn gemeinsam mit Angelika Schnell, sich an diesen nicht abzuarbeiten, sondern seine eigene Geschichte zu schreiben. Er hatte ohnehin schon einen fulminanten Text als Alt-68er über seine Jugend und Studienzeit für ein Forschungsvorhaben von Wolfgang Kraushaar geschrieben, in dem sich Persönliches mit Politischem und Fachlichem in einer dichten Erzählung verband.
Einige Zeit später schickte er Angelika und mir das Rohmanuskript mit der Bitte zu einem schnellen Feedback zu. Mit Bedauern stellten wir fest, dass mit dem Beginn der Arch+-Geschichte die persönliche Dimension in dem Text abbrach, obwohl sie stets eine prägende Rolle gespielt hatte. Ich schickte Nikolaus ein ausführliches, aber auch beherztes Feedback und hörte nichts mehr von ihm dazu. Einige Zeit später erschien der Text in weiterentwickelter Form bei Arch+ als seine „architektonische Selbstbiografie“. Er war zwar meinungsfreudig und nahm auch mal gerne provokante Positionen ein und polarisierte. Aber andererseits konnte er auch konfliktscheu sein und offene Kontroversen meiden. Wenn ihm ein Text eines Autors enttäuschte und er diesen nicht veröffentlichen wollte, ging er eher auf Tauchstation und ließ es ins Leere laufen. Als ich ihn zuletzt traf, überraschte er mich mit einer mir von früher unbekannten Art der Nachdenklichkeit. Es war nicht immer einfach mit ihm, aber er hat mich in einer wichtigen Phase maßgeblich geprägt. Ihm verdanke ich, für mich einen Weg gefunden zu haben, meiner Beschäftigung in der Architektur nachzugehen, die mir und meinem Selbst- und Weltverständnis entspricht.