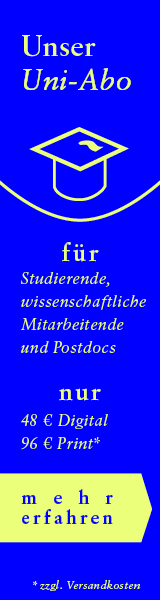Doch ein Strukturwandel? Eine Entgegnung auf Jan Wieles Polemik
Literaturkritik steht im Feuer, keine Frage. Jan Wiele hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 5. März 2025 seiner Frustration über diese Entwicklung Luft verschafft und dazu meinen Aufsatz zum Strukturwandel der literarischen Öffentlichkeit aus dem März-Heft dieser Zeitschrift ausgesucht. Damit hat er allerdings den falschen Gegner gewählt. Denn wie er bin auch ich in meinem Artikel der Meinung, dass es Experten wie Literaturkritiker geben sollte, Feuilletons eine wunderbare Einrichtung sind, die man erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe, und dass es schlechte Bücher gibt, die man auch so nennen sollte. Wir gehören derselben Stilgemeinschaft an. Dennoch hat Wiele eine Gattung gewählt, die das Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft als „aggressive, auf Bloßstellung und moralische oder intellektuelle Vernichtung abzielende, gleichwohl argumentierende Kritik am Gegner in einem Streit“ beschreibt, als Polemik. Das lohnt eine Entgegnung.
Ich kenne Jan Wiele nicht, noch sind wir uns bisher über ein Thema über Kreuz gekommen. Eher darf vermutet werden, dass hier die Deutungshoheit über die Kultur einer sich exklusiv verstehenden Gruppe verteidigt werden und eine nicht legitimierte Stimme außen vorgehalten werden soll. Daher der polemische Ton und der karikierende Versuch, eine Nähe zur AFD zu erfinden, weil in dem Merkur-Artikel zwischen Referenzen auf Argumente von Jürgen Habermas und Gerhard Schulze, Andreas Reckwitz und Steffen Mau auch der in der Diskussion um einen möglichen Strukturwandel der Öffentlichkeit verschiedentlich zitierte Historiker Andreas Rödder mit seiner These von „Kultur der Inklusion“ zitiert wird. Das mag man für eine schlechte Referenz halten, man kann aber nicht ganz ignorieren, dass diese These und ihr Autor wiederholt im Zusammenhang mit dem Strukturwandel genannt und diskutieren werden, auch im Merkur. Ich habe das also nicht erfunden, sondern bin hier nur einer philologischen Ehrlichkeit verpflichtet. Aber geschenkt, denn offensichtlich gehört das für Wiele zum Klappern mit dem Besteck der Gattung Polemik. Und die Funktion dieses Klapperns ist hier unmissverständlich, den erfundenen Gegner wenigstens irgendwie moralisch zu diskreditieren.
Wiele hat gleichwohl ein Argument, das die Betrachtung lohnt. Seiner Ansicht nach ist Literaturkritik im Verschwinden begriffen, weil Verlage auf schlechte Bücher setzen und Literaturredaktionen abgebaut werden. Das ist kein Strukturwandel, sondern blanker Abriss. Daher sei es dann nichts anderes als eine Beförderung dieses Abrisses, so Wiele, wenn man die Fankultur um das Buch und die Sozialfigur der jungen Leserin als Symptome für einen Strukturwandels deutet. Mein Essay im Merkur, das scheint mir der Kern seines Vorwurfs zu sein, hat die Trivialisierung des Kulturbetriebs unter dem Deckmantel der empirischen Sozialwissenschaft betrieben.
Tatsächlich und zum Glück aber ist das nicht die Argumentationslinie. Zunächst konstatiert mein Beitrag, dass es sich um eine illegitime Kunst handelt, die die Hallen auf der Frankfurter und Leipziger Buchmesse zum Überlaufen bringt. Illegitim ist sie, weil sie weder über ein Mandat der Buchbranche noch über eines des Literaturbetriebs verfügt. Im Unterschied zu Wiele aber diskutiere ich, inwieweit die Fankultur um das Buch eine freche Entstrukturierung der literarischen Öffentlichkeit vorführen oder womöglich sogar eine legitime Neustrukturierung anzeigen könnte. Ich prüfe dann eine Reihe von Ansätzen, die versuchen, die Entwicklung theoretisch zu fassen. Teils stimme ich einigen Diagnosen zu, komme aber zu dem Schluss, dass eine Reihe von Ansätzen den bisherigen Literaturbetrieb überschätzen, die literaturhistorisch längere Tradition der Verbindung von Populär- und Hochkultur unterschätzen und die Befunde zum Stand des Buchlesens als bloße Ausdünnung des Lesens verkürzen. Es gibt angebbare Gründe, die gewachsene kulturelle Beteiligung gerade auch von Minderheiten positiv zu werten, auch wenn sich ‚junge Leserinnen‘ wie Rupi Kaur, Lang Leav oder Dua Lipa nicht an die Regeln des bisherigen Literaturbetriebs halten. Traditionell wird das als Massenkultur und ihr Lesestoff als Massenbuch abgewertet. Mein Essay verweist auf die Möglichkeit, das auch als Demokratisierung der kulturellen Partizipation zu verstehen. Hier kann Jan Wiele zu einem anderen Urteil kommen, aber er kann nicht behaupten, dass derjenige, der die jüngeren Phänomene in der literarischen Öffentlichkeit als eine Demokratisierung der Kultur bewertet, per se Unrecht hat. Bewertungen sind nicht mit Wahrheitsansprüchen gleichzusetzen. Gerade in einer sich so anders zusammensetzenden Gesellschaft wie der gegenwärtigen hängt so viel von der Partizipation vieler an der Kultur ab, auch derjenigen ohne Mandat und nicht selten auch ohne ästhetisches Urteilsvermögen.
Ebenso unterschiedlich lässt sich mit einigem Recht die Fankultur um das Buch bewerten. Natürlich ist demonstratives Fanverhalten oft bizarr, nicht selten eher bildungsfern und manchmal auch dümmlich. Aber Bildung, so argumentiere ich, verläuft nicht sortiert von Robert Louis Stevenson zu Friederich Hölderlin, sondern begann schon früher mit dem Heftroman-Lesen unter Bank. Wenn heute Stars wie Rosamund Pike Romane Thomas Hardys empfehlen und BookToker Dostojewskis Novelle Weiße Nächte so sehr feiern, dass Luke Thompson, der Darsteller von Benedict Bridgerton aus der gleichnamigen Netflix-Serie, das Hörbuch einspricht, mögen das manche verachten, aber es bildet Leser, sehr viele Leser gerade dort, wo der etablierte Literaturbetrieb nicht hinreicht. Mein Argument ist schlicht, dass wir auf solche Bildungsüberstiege zwischen der Populärkultur und der Hochkultur angewiesen sind und es auch historisch waren. Dua Lipas Buch-Podcast mag vielleicht Jan Wiele nicht gefallen, aber auch ihre Buchvorstellungen tragen zum Lesen zumeist ziemlich guter Bücher bei. Und selbst dort, wo einfach nur über das Gelesene geweint wird, und das massenhaft auf Sozialen Medien geteilt wird, tragen solche Videos zur affektiven Bildung der Gesellschaft bei. Man mag das verachten und mit einigen durchaus guten Gründen eine argumentierende Literaturkritik für überlegen halten, es aber nicht in das Tableau der Veränderungen in der literarischen Öffentlichkeit mit einzubeziehen, macht uns blind für die Veränderungen unserer Gegenwartsgesellschaft.
Insofern bin ich meinetwegen Fan der Buch-Fans, wie es jeder Sozialwissenschaftler fast unvermeidlich sein muss, der sich anschaut, wie wichtig Sportvereine für diese Gesellschaft sind, auch wenn ihn sonst Sport nicht interessiert. Ich muss die Bücher von Rebecca Yarros weder ästhetisch noch inhaltlich gut finden und habe öffentlich Rupi Kaurs Lyrik auch als Kalenderlyrik in Zeitungsartikeln bewertet, als man sie in Deutschland noch nicht öffentlich diskutiert hat. Aber ich muss zumindest zu einem gewissen Grad anerkennen, dass auch deren Bücher vergemeinschaftend, vielleicht sogar vergesellschaftend wirken. Die ‚Bookaholics‘ sind für unsere Gesellschaft zu wichtig, um sie einfach als Verfallssymptom zu verbuchen. Noch einmal: Man kann man auch hier zu einer anderen Bewertung kommen und mein Essay lässt offen, wie weit hier schon von einer qualitativ anderen literarischen Öffentlichkeit zu sprechen wäre. Indem ich auf die schablonenhafte Sozialfigur der ‚jungen Leserin‘ aufmerksam mache, versuche ich aus den argumentativen Limitierungen der Kulturkritik auszubrechen und Vorschläge zu machen, wie Sinn und Bedeutung der neuen Kulturpartizipation verstanden werden könnten. Nur Kulturkritik zu betreiben, wäre mir zu wenig.
Angesichts populärer Leserschaften mag sich die Kritik auf die Polemik zurückziehen und das Unbehagen in der Massenkultur ihrerseits wortreich artikulieren. Am Ende des Essays argumentiere ich, dass Hierarchien in Sachen Kultur nicht per se verkehrt sind. Eine unterschiedslose Demokratisierung des Urteilsvermögens ist in Kulturdingen nicht erstrebenswert, da teile ich Wieles Einschätzung, so sehr auch erst historisch die Veralltäglichung der Ästhetisierung zur Verbürgerlichung unserer Gesellschaft beigetragen hat. Aber es gilt anzuerkennen, dass in diesem Prozess der Verbürgerlichung die Zunahme immer neuer Akteure und Institutionen zu einer Enthierarchisierung von Rollen geführt hat. Die etablierte Literaturkritik ist deshalb nicht überflüssig, sie nimmt nur eine bescheidenere Rolle in einer vielstimmigeren Öffentlichkeit ein. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung rezensiert inzwischen Kriminalromane, das populärste Literaturgenre überhaupt.
Das ist also mein Punkt: Derzeit ändern sich Rollen und Institutionen, die teils ungefragt und manchmal vorlaut mitbestimmen, was literarische Öffentlichkeit ausmacht. Wir verstehen Sinn und Bedeutung dieses Kulturwandel noch unzureichend. Ich habe einen Vorschlag gemacht und auf andere, konkurrierende Vorschläge zum Verständnis des gegenwärtigen Wandels aufmerksam gemacht. Mit Jan Wiele meine ich, dass sich der Streit um die literarische Öffentlichkeit lohnt. Aber es sitzen mehr am Debattentisch als nur wir beide aus derselben Stilgemeinschaft.