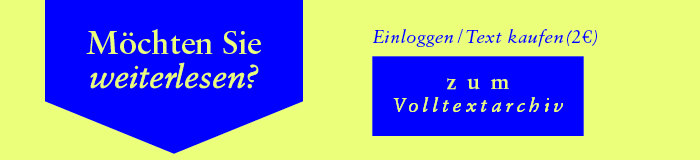Konkurrenz oder Koproduktion. Zur Erinnerung an Holocaust und Kolonialverbrechen
Die Kritik an der deutschen Holocaust-Erinnerung ist so alt wie diese selbst. Dabei war und ist die Stoßrichtung der Kritik immer auch Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen und Kontroversen. So wird seit einigen Jahren im Kontext einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft die These geäußert, dass die Aufmerksamkeit auf die Schoah die Erinnerung an die koloniale Vergangenheit in Deutschland behindert habe. Um dies zu plausibilisieren, verweisen Forscherinnen auf ein Modell der Aufmerksamkeitsökonomie, demzufolge der Holocaust »die Aufmerksamkeit von Historikern und Kulturwissenschaftlern beansprucht [habe] und im Vergleich andere Fluchtlinien der deutschen Geschichte als marginal erscheinen« lasse.1
(Dieser Text ist im Septemberheft 2022, Merkur # 879, erschienen.)
Andere wiederum argumentieren kollektivpsychologisch und behaupten, das deutsche Verständnis der »Aufarbeitung« des Holocaust folge einer teleologischen Logik, derzufolge die Schuld des Holocaust durch das öffentliche Gedenken gesühnt sei. Diese Auffassung mache für andere Formen des Rassismus und der Ausgrenzung blind.2 In einer zuletzt zunehmend schrill geführten Debatte wird daneben auf die Rolle »selbsternannter ›Hohepriester‹«, »Glaubenswächter« oder nicht weiter spezifizierter »Eliten« verwiesen, welche die deutsche Bevölkerung im Sinne einer »Holocaust-Orthodoxie« zu »disziplinieren« suchten.3
Wirft man einen genaueren Blick auf die Erinnerungskultur anderer Länder, verlieren diese Erklärungsmodelle allerdings erheblich an Plausibilität. Schließlich stellt die Ignoranz gegenüber der eigenen Kolonialvergangenheit keineswegs ein rein deutsches Phänomen dar. Wenn das aber so ist, spricht denkbar wenig dafür, sich bei der Suche nach den Ursachen für die koloniale Amnesie auf die Erinnerung an die Schoah zu konzentrieren. Eine europäisch vergleichende Perspektive legt vielmehr nahe, dass das Vorbild der Holocaust-Erinnerung die Auseinandersetzung mit Kolonialverbrechen mitunter sogar gefördert haben dürfte.4
1946 wurde im norddeutschen Itzehoe auf Initiative von Gyula Trebitsch, einem ungarisch-jüdischen Überlebenden von Zwangsarbeit, Konzentrationslager und Todesmarsch, das erste öffentliche Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Deutschland errichtet. Nachahmer fand dieser frühe Akt des Erinnerns allerdings nicht. Stattdessen wurde das Mahnmal elf Jahre später von seinem Platz im Zentrum der kleinen Stadt wieder entfernt.5 Im selben Jahr dachte der deutsche Historiker Hermann Aubin über die Geschichte des Abendlands nach. Dabei fand er lobende Worte für das »nationale Bekenntnis, mit dem auch der Nationalsozialismus angetreten ist«. In »der reinen Form Herders und der deutschen Romantik« bedeute dies nämlich »mit der Bejahung des eigenen Volkstums als eines hohen Lebenswertes zugleich die Anerkennung aller anderen Volkstümer«.6
Nicht den Deutschen, sondern dem ironisch als »Befreier« titulierten Russland warf der damalige Präsident des Verbands Deutscher Historiker denn auch vor, das Abendland und die »eben erst sich wieder ankündigende europäische Gemeinschaft« zerstört zu haben. Angesichts der »Beschneidung des deutschen Staatsgebietes im Osten« und der »Massenaustreibungen der Deutschen« sei diese Gemeinschaft womöglich dauerhaft verloren gegangen, so Aubin. Schließlich sei es Deutschland »heute genommen, so wie in allen Jahrhunderten seinen hoch zu wertenden Beitrag zum Aufbau dieser Gefahrenzone in abendländischem Geiste zu leisten«.
(…)