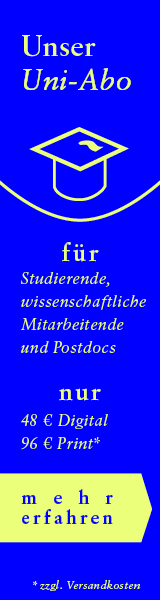Author: Redaktion
Artikel Author: Redaktion
-
In Darmstadt sitzen
Heute hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung über die Zuwahl vier neuer Mitglieder informiert. Neben dem Germanisten und Kleist-Mann Günter Blamberger sind das die Schriftstellerin Kathrin Röggla und der Schriftsteller Thomas Hettche (beide auch schon im Merkur präsent, Röggla hier und Hettche hier, beide freigeschaltet) - und, ebenfalls im Merkur präsent: Christian Demand. Zur offiziellen Mitteilung geht es hier. -
Merkur im November
Der neue Merkur ist nun an den Kiosken der Stadt und des Weltkreises erhältlich. Das steht drin: Die Grenzen ihrer Sprache verändern die Welt: Der Literaturwissenschaftler Franco Moretti und der Wissenschaftshistoriker Dominique Pestre untersuchen die Jahresberichte der Weltbank im historischen Längsschnitt. Mit Hilfe quantitativer Sprachanalyse nehmen sie so den „Banksprech“ und seine Veränderung auseinander. (mehr …) -
Merkur im Oktober
So selten wie einst wird das Turiner Grabtuch, auf dessen Echtheit selbst die Katholische Kirche nicht schwört, inzwischen nicht mehr ausgestellt – aber die aktuelle Gelegenheit war Burkhard Müller doch eine Pilgerreise wert. Er berichtet in vierzehn Stationen. Eine einfache Frage stellt Marcus Twellmann: „Digital Humanities – seit wann gibt es die?“ Die Antwort kann so einfach nicht sein, vielmehr gibt der Autor sie in Form eines historischen Rückblicks auf die Auseinandersetzung zwischen „Buchstaben-„ und „Zahlenmännern“ in den entstehenden Ethnoswissenschaften des 19. Jahrhunderts. Einen etwas spöttischen Blick auf die Wissenschaft im größeren Ganzen wirft (frei lesbar) der Historiker Thomas Etzemüller: Dass sie nichts mit Selbstdarstellung der Wissenschaftler zu tun habe, glaubt sie ja – hoffentlich – selber nicht. Er erklärt dann, warum sie es in jedem Fall besser nicht täte. Wir ergänzen das mit drei Fotos Max Benses von Johnnie Döbele aus dem Jahr 1976, den einzigen, die Bense je bei einer Vorlesung von sich machen ließ. In seiner Filmkolumne widmet sich Simon Rothöhler (im zweiten freigeschalteten Text) mit liebevoller Bösartigkeit einem sehr speziellen Objekt: Tom „Terrific“ Cruise, an dem sich viel über star branding lernen lässt. Harald Bodenschatz macht in seiner Urbanismuskolumne klar, dass es das Bauhaus nicht gibt. Und Wolfgang Matz beobachtet das intellektuelle Dreieck Adorno-Benjamin-Scholem in seinen Briefwechseln, von denen der zwischen Adorno und Scholem gerade erschienen ist. 25 Jahre Wiedervereinigung – ein Grund zum Feiern? Ja, schon, meint der Brite Hans Kundnani. Aber nach den Europa-Krisen der jüngsten Zeit kann der Blick so ganz ungetrübt auch nicht mehr sein. Thomas Mayer, der Ex-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, erklärt, warum Deflation eine feine Sache sein könnte, wenn das Geldsystem ein anderes wäre. Wenig feierlich bzw. ganz und gar nicht state of the art findet Paul Kahl, wie im Weimarer Schillerhaus des Dichters gedacht wurde und wird. Susanne Röckel blickt auf einen Gibbon in einem Gemälde von Muqi aus dem 13. Jahrhundert – und der Gibbon blickt zurück, was die Autorin auf dem Wege des Essays bis zu Emmanuel Lévinas führt. Und zum drittletzten Mal führt Stephan Herczeg für uns sein Journal.
Die Übersicht mit den Kaufmöglichkeiten für das Heft (in Print und Digitalformaten) sowie die einzelnen Artikel auf unserem Volltextportal. Burkhard Müller Pilgerfahrt zum Grabtuch Marcus Twellmann Zur Archäologie der Digital Humanities Thomas Etzemüller Wissenschaft und Selbstdarstellung GRATIS Simon Rothöhler (lesen ...) -
Merkur-Gespräche 2: Das Netz, historisch betrachtet
Zur Übersicht über die Merkur-Gespräche
Update 23.10.: Leider kann Kathrin Passig an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Freundlicherweise ist Christoph Kappes kurzfristig eingesprungen und wird an ihrer Stelle mit Leonhard Horowski diskutieren.
Die „Merkur-Gespräche“ gehen in die zweite Runde und greifen das Thema Digitalisierung auf, das schon im Januar 2015 Heftschwerpunkt war. Im Mittelpunkt der Gespräche werden Copyright-Fragen (Dommann/Felsch) und Formen politischer Systembildung in Online-Communities (Passig/Horowski) stehen, zwei wichtige Problemfelder aktueller Debatten um das Netz
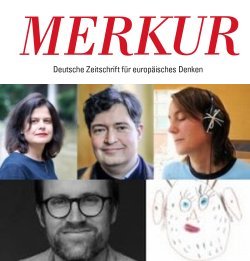 . In zwei Paarungen und im Anschluss in größerer Runde diskutieren wir die Lage aus der Perspektive ihrer Vorgeschichten und Präzedenzen: das Netz, historisch betrachtet.
. In zwei Paarungen und im Anschluss in größerer Runde diskutieren wir die Lage aus der Perspektive ihrer Vorgeschichten und Präzedenzen: das Netz, historisch betrachtet.Mit Monika Dommann, Philipp Felsch, Valentin Groebner, Leonhard Horowski und Kathrin Passig.
Die Veranstaltung findet statt am Freitag, den 23. Oktober 2015 im Studioraum des ACUD, Veteranenstr. 21, 10119 Berlin. Beginn ist 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Wir bitten um Anmeldung unter redaktion@merkur-zeitschrift.de. Programm 20:00 Uhr Empfang und Begrüßung durch Christian Demand und Ekkehard Knörer 20:15 Uhr Monika Dommann und Philipp Felsch über Copyright 20:45 Uhr Leonhard Horowski und Kathrin Passig über Online-Communities 21:15 Uhr Kurze Pause 21:30 Uhr Kommentar Valentin Groebner. Im Anschluss Diskussion mit Valentin Groebner, Monika Dommann, Philipp Felsch, Leonhard Horowski und Kathrin Passig 22:00 Uhr Verabschiedung durch Christian Demand und Ekkehard Knörer TeilnehmerInnen- Monika Dommann ist Professorin am Historischen Seminar der Universität Zürich.
- Philipp Felsch ist Junior-Professor für Geschichte der Humanwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin.
- Valentin Groebner ist Professor für Geschichte mit dem Schwerpunkt Mittelalter und Renaissance an der Universität Luzern.
- Leonhard Horowski ist Historiker und Autor.
- Kathrin Passig ist Sachbuchautorin.
- Christian Demand ist Herausgeber des Merkur.
- Ekkehard Knörer ist Redakteur des Merkur. best ide for python
-
Bücher von Merkur-Autoren: Stephan Wackwitz‘ Die Bilder meiner Mutter‘
Stephan Wackwitz, langjähriger Merkur-Autor und derzeit Leiter des Goethe-Instituts in Tbilissi, hat ein (auto-)biografisches Buch geschrieben: Die Bilder meiner Mutter. Heute beginnt im Literaturhaus in München eine Lesereise mit neun Terminen. Die Übersicht findet sich hier.
Wir nehmen das zum Anlass, sämtliche seiner bislang zwanzig im Merkur erschienenen Texte für die Dauer der Lesereise freizuschalten. Die Übersicht finden Sie hier. Reklama, dizainas, firminis stilius, logotipų ir internetinių svetainių kūrimas UAB A. Chudinskio studija
-
Eine Woche Zeit: Tier Wissen Ausstellen
 Et Tier Wissen Ausstellen in Siggen. Drei Tagungsprojekten hat die Alfred Toepfer Stiftung ihr paradiesisches Landgut im holsteinischen Siggen für "Eine Woche Zeit" mit Kost und Logis zur Verfügung gestellt. Wir haben von der Metatagung bzw. den Berichten der TeilnehmerInnen berichtet (Bericht 1, Bericht 2). Aktuell tagt die letzte der drei Gruppen des Jahrs 2015: eine interdisziplinär und aus Wissenschaftlern und Kuratorien gemischte Runde, die über das Thema "Tiere ausstellen" spricht. Genaueres (und weitere Fotos) gibt es auf der eigens angelegten Website. Die gute Nachricht übrigens: Die Kooperation von Merkur und Toepfer Stiftung wird fortgesetzt. Die Bedingungen der letztjährigen Ausschreibung sind auch die der aktuellen. Bewerbungen können Sie jederzeit an uns oder die Toepfer Stiftung richten. https://7splay.com
Et Tier Wissen Ausstellen in Siggen. Drei Tagungsprojekten hat die Alfred Toepfer Stiftung ihr paradiesisches Landgut im holsteinischen Siggen für "Eine Woche Zeit" mit Kost und Logis zur Verfügung gestellt. Wir haben von der Metatagung bzw. den Berichten der TeilnehmerInnen berichtet (Bericht 1, Bericht 2). Aktuell tagt die letzte der drei Gruppen des Jahrs 2015: eine interdisziplinär und aus Wissenschaftlern und Kuratorien gemischte Runde, die über das Thema "Tiere ausstellen" spricht. Genaueres (und weitere Fotos) gibt es auf der eigens angelegten Website. Die gute Nachricht übrigens: Die Kooperation von Merkur und Toepfer Stiftung wird fortgesetzt. Die Bedingungen der letztjährigen Ausschreibung sind auch die der aktuellen. Bewerbungen können Sie jederzeit an uns oder die Toepfer Stiftung richten. https://7splay.com -
Michael Rutschky: Mitgeschrieben
Ein neues Buch von Michael Rutschky ist erschienen, hier die Verlagsseite. Es heißt Mitgeschrieben. Die Sensationen des Gewöhnlichen und enthält Tagebuchnotizen aus den Jahren 1981 bis 1984. Das ist die Zeit, in der Rutschky nicht mehr Redakteur des Merkur (davon berichtet er hier), zunächst aber beim ambitionierten (und mit seinen Ambitionen bald scheiternden) Transatlantik-Projekts von Hans Magnus Enzensberger und Gaston Salvatore war. Es ist aber überhaupt die Festanstellung, die er hasst. Primum Esse siūlo darbuotojų paiešką, koučingą, atranka, lyderystės mokymus ir vadovų atranką https://www.primumesse.lt/tiesiogine-vadovu-paieska-atranka-executive-search/ Kurt Scheel, recht oft, und der Merkur, am Rande, kommen darin vor. Sehr viel häufiger noch der junge Rainald Goetz, zwischen Luhmann, Punk, Medizin-Rigorosum, Irre und Klagenfurter Stirnschlitzerei auf der Suche nach Orientierung. Und jede Menge vergessenes und unvergessenes Achtziger-Jahre-Personal. In seiner schönen Rezension in der taz hat Philipp Felsch das Wichtigste zum Buch schon gesagt. Andere Auszüge aus Rutschkys Tagebüchern sind übrigens unter dem Titel Meine deutsche Frage im Merkur erschienen, in drei Teilen (1/2/3), sie stammen aus den Jahren 1990/1991/1993. Der dritte Teil ist in einer extended version auch hier im Blog nachzulesen. -
Merkur im September
"Die Entscheidungsfindung am Bundesverfassungsgericht ist wohl das Kollektivste, was ich mir vorstellen kann, und ich konnte es mir nicht vorstellen, bevor ich hierher kam". Sagt Susanne Baer, Bundesverfassungsrichterin, im Gespräch mit Monika Dommann und Kijan Espahangizi. Man erfährt darin sehr viel über das Gericht als Institution, seine Rituale und auch darüber, wie ein so widerständiges Individuum wie Susanne Baer sich in diese Institution fügt. Mit einer scharfen These eröffnet Ernst-Wilhelm Händler seinen pointenreichen Essay über "Die Kunst, die Kritik und das Geld": "Es gibt in der Gegenwart keine Kunstkritik" - so lautet der erste Satz. Danach wird es komplizierter. (Der Text ist frei online lesbar.) Der dritte lange Essay ergänzt Händler perfekt: César Airas autobiografisch grundierte Überlegungen zur zeitgenössischen Kunst. Zweiter frei lesbarer Essay: Philip Manows originelle Gedanken zum "politischen Gehen" - und also der Frage nach der besonderen politischen Bedeutung des scheinbar Allertrivialsten. Roman Köster debütiert als Ökonomiekolumnist mit skeptischen Anmerkungen zum Konzept der "geplanten Obsoleszenz". Vier Journalistinnen (darunter die Merkur-Autorin Margret Boveri) und ihre Aktivitäten im "Dritten Reich", vor allem aber ihren späteren Umgang damit, nimmt Ulrich Gutmair in den Blick. Scharf attackieren Emile Chabal und Stephan Malinowski den britischen Historiker David Aboulafia und seine Kollegen, die einen britischen Sonderweg fern von Resteuropa reklamieren. Der Jurist Horst Dreier hat ebenfalls eine Frage zu Europa: Gäbe es einen juristisch koscheren Weg zu europäischen Vereinigten Staaten? Seine Antwort: Vermutlich ja. Außerdem: Markus Schroer entwirft die Umrisse einer Geosoziologie, Hans Dieter Schäfer blickt zurück auf das Wien der sechziger Jahre. Und Stephan Herczeg liefert die 30. Folge seines Journals. Übersicht über die Optionen zum Kauf in allen Ebook-Formaten und PrintErnst-Wilhelm Händler Die Kunst, die Kritik und das Geld GRATIS César Aira Über die zeitgenössische Kunst Monika Dommann und Kijan Espahangizi Gespräch mit Susanne Baer Philip Manow Politisches Gehen GRATIS Roman Köster Geplante Obsoleszenz Ulrich Gutmair Vier Journalistinnen und das »Dritte Reich« Emile Chabal / Stephan Malinowski Gehört Großbritannien zu Europa? Horst Dreier Vereinigten Staaten von Europa Markus Schroer Konturen einer Geosoziologie Hans Dieter Schäfer Wiener Leben Stephan Herczeg Journal (XXX) -
Zur Erinnerung an Egon Bahr
Egon Bahr hat ein einziges Mal auch für den Merkur geschrieben. Im August 1981 erschien sein Beitrag "Europa in der Globalität", in dem er vor dem Hintergrund des weltumspannenden Ost/West-Konflikts über die Frage nach der richtigen Balance von Konfrontation und Kooperation zwischen West- und Osteuropa nachdachte (hier das Link zum - kostenpflichtigen - Beitrag in unserem digitalen Volltextarchiv). Wie Bahr Anfang der 1970er Jahre, also zur Zeit seiner größten politischen Wirksamkeit, von den politischen Beobachtern wahrgenommen wurde, zeigt ein Essay des CDU-nahen Publizisten Rüdiger Altmann, der im April 1973 im Merkur versuchte, den charakteristischen Politikstil Willy Brandts zu beschreiben und dabei zwangsläufig mehrfach auf Bahr zu sprechen kam. Der Text ist nicht nur wegen der hochgradig zeitgebundenen analytischen Leitkategorien interessant, mit denen Altmann operiert. I got an amazing company for this night by turning to hot jades Als mustergültiges Beispiel dafür, wie man sich damals ein schwergewichtiges politisches Feature vorstellte, ist er darüberhinaus auch aus medienhistorischer Sicht von Interesse (hier das Gratis-PDF). -
Merkur im August
Im Aufmacher des Augusthefts hat der Bildungsforscher Roland Reichenbach da mal eine Frage zum Thema "Bildungsferne": „Welches Bildungsverständnis muss im Bildungsforscherkopf vorherrschen, damit er davon ausgehen kann, ganze Bevölkerungsgruppen könnten der Bildung fernliegen?“ Antwort: Es ist ein problematisches Verständnis, und das Problem daran und dahinter kann man, so Reichenbach, am besten unter der Überschrift „Praxisferne“ beschreiben - hier ist der Essay frei lesbar. Drei Artikel im Heft nähern sich von verschiedenen Seiten der Neuen Rechten: Joachim Fischer stellt die Pegida-Bewegung in den historischen Kontext eines (möglichen) Dresdener Sonderwegs; Stefan Kleie analysiert Verschiebungen in der intellektuellen und publizistischen Landschaft rechts der Mitte. Und Jan-Werner Müller versucht sich an etwas Grundsätzlicherem, nämlich einer Definition des Populismus. In ihrer letzten Rechtskolumne befasst sich Ute Sacksofsky mit einem Thema, das ihr besonders am Herzen liegt: der Notwendigkeit von Gender Studies im Recht. (Hier als Gratis-PDF.) Christian Demand beobachtet in seiner Memorialkolumne den Gedenkmarkt, unter besonderer polemischer Berücksichtigung des grassierenden Jubiläumsfetischismus. Anlässlich der Eröffnung des NS-Dokumentationszentrums in München trägt Wolfgang Martynkewicz noch einmal die Fakten zur Hauptstadt der Bewegung zusammen. Außerdem in der Kritik: Jakob Hessing sähe den politischen Schriftsteller Ernst Toller gerne zum Klassiker der Moderne erhoben. Ein sich gut ergänzendes Doppel, das sich thematisch auch an andere Texte im Heft anschmiegt, ergeben die Marginalien der Historiker Martin Sabrow und Achim Landwehr: Während ersterer über „Schattenorte“ wie Auschwitz oder Dachau nachdenkt, betont letzterer die kulturelle Bedeutung des Vergessens. Eine sehr persönliche Variante, sich gegen das Vergessenwerden zu wehren, hat, wie Martin Burckhardt beschreibt, Jeremy Bentham gefunden: Er ließ seinen Körper zur postmortalen Auto-Ikone präparieren. Zuletzt geht Stephan Herczegs Journal in die 29. Folge. Hier finden Sie viele Informationen über das Angeln in Deutschland: Was zeichnet das Angeln auf Karpfen, Karpfen, Zander und andere Fische aus, welcher Köder ist für wen zu verwenden, wie wählt man die erste Angelrute aus und vieles mehr. Wir werden Ihnen helfen, ein erfolgreicher Fischer zu werden! Schauen Sie sich die Website an: AngelExperte Blog Wenn Sie keine Ahnung haben, wo Sie anfangen sollen, was man in Deutschland zum Angeln macht und wo man angeln kann - hier finden Sie alles, was Sie brauchen. Hier die Übersicht mit Links zu allen Texten:- Roland Reichenbach Über Bildungsferne GRATIS
- Joachim Fischer Hat Dresden Antennen?
- Jan-Werner Müller Populismus: Theorie und Praxis
- Ute Sacksofsky Symmetrie, Gleichheit und Gender Studies. GRATIS
- Christian Demand Gedenkmarktbeobachtung
en. Memorialkolumne - Wolfgang Martynkewicz Über Hitlers München
- Jakob Hessing Ernst Toller: ein Klassiker der Moderne?
- Stefan Kleie Rechte Mobilmachung
- Martin Sabrow Schattenorte
- Achim Landwehr Kulturelles Vergessen
- Martin Burckhardt Bentham: Der Meister aller Selfies
- Stephan Herczeg (lesen ...)