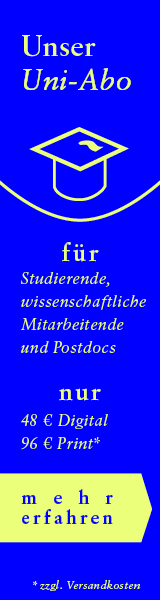Author: Redaktion
Artikel Author: Redaktion
-
Jetzt erschienen: Merkur 793, Juni 2015
Ist die Universität noch der Ort der Intellektualität - oder war sie es im Grunde nie? Was sind die Folgen der Bologna-Reformen und der Exzellenzinitative? Um Fragen wie diese geht es im sechs Texte umfassenden Schwerpunkt des Junihefts "Zur Lage der Universität". Darüber unterhalten sich zwei Akademiker, die auch als öffentliche Intellektuelle sichtbar sind, nämlich der Akzelerationismus-Vordenker und Merve-Autor Armen Avanessian und der als Kapitalismusanalytiker Literaturwissenschaftler Joseph Vogl - dieses Gespräch ist frei online zu lesen. Mit der einigermaßen niederschmetternde Situation für den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs setzt sich Remigius Bunia in seinem Essay auseinander, der neben vielen Fakten und Zahlen auch Einblick in seine Erfahrungen als Vorsitzender des Verbands der Juniorprofessoren gibt. "Wie halte ich es mit der Universität?", so ungefähr lautet die Gretchenfrage, die Hanna Engelmeier stellt - das klingt persönlich, aber die Antworten erlauben einen tiefen Blick in die Strukturen und Verhältnisse eines Milieus. Außerdem geht es um die teils das Lächerliche streifende Leitbildprosa in den Selbstbeschreibungen der Universitäten, um die Zukunft der Reform und, in einem Essay von Jan-Werner Müller, um die alles andere als märchenhafte Situation an den oft als Vorbilder gepriesenen US-Universitäten. Sarah Birke und Peter Harling kritisieren die hilflosen und inkonsistenten Versuche des Westens, den "Islamischen Staat" zurückzudrängen. In seiner letzten Geschichtskolumne schreibt Sebastian Conrad über den Wandel der Zeitvorstellungen aus globaler Perspektive. Ekkehard Knörer liefert - frei lesbare - Neuigkeiten aus dem Literaturbetrieb, die nicht zuletzt den allgegenwärtigen Hubert Winkels betreffen. Außerdem schreibt Roman Köster als Wirtschaftshistoriker über die Weimarer Jahre, Claude Haas kritisiert die Drohnenkritik als rückwärtsgewandt und Stephan Herczeg setzt sein Journal fort. Hier die ausführliche Übersicht über das Heft - und hier die Möglichkeiten zum Kauf (Print, Download von Einzelartikeln und ganzem Heft in E-Formaten). Our great atmosphere and safe environment make it super easy for you to fall in love with our sexy chat If you want to enjoy some flirting, chatting and sexting and have some fun with local sexy girls then you need to get online and use a sexy chat room. Das Blog wird den Schwerpunkt Universität den Juni über begleiten: mit Links zu aktuellen Texten, Hinweisen und Textausschnitten aus dem Merkur-Archiv - und mit kurzen Originalbeiträgen zum Thema. -
Seibt zu Jauß
-
Jetzt neu: Merkur 792, Mai 2015
 Im Maiheft des Merkur nimmt Friedrich Wilhelm Graf kein Blatt vor den Mund: "Die beiden großen deutschen Volkskirchen sind nur noch erschreckend geistlose Organisationen."In Grafs Essay geht es dabei um ein schlagendes Beispiel: die strikte Ablehnung des ärztlich assistierten Suizids. Diese ist auch theologisch falsch, erklärt Graf, und warum das so ist, kann man nicht nur im Heft, sondern auch frei online nachlesen. Uns hat Grafs fundierter Furor so überzeugt, dass wir für ihn die Heftarchitektur umgestürzt haben: Was als Kolumne geplant war, ist nun der Aufmachertext.
Der 1996 verstorbene Philosoph Hans Blumenberg – der übrigens nie im Merkurveröffentlicht hat – hat postum weiter Hochkonjunktur. Auf einige Texte in jüngerer Zeit folgt ein Doppel, das weniger die Redaktion als der Zufall der Angebotslage gefügt hat. Birgit Recki, selbst Blumenberg-Schülerin, porträtiert den Denker und Lehrer so leidenschaftlich wie kenntnisreich. Im zweiten Artikel, einem Rezensionsessay, geht es um Blumenbergs zunächst positive, dann kritische Haltung zu Hannah Arendt; eine Entwicklung, die Hannes Bajohr auch anhand unveröffentlichter Dokumente aus dem Literaturarchiv in Marbach sehr präzise nachzeichnen kann. Spiel beste friv spiele auf der seite friv spiele jetzt.
Im Januar hatten wir einen Schwerpunkt zur Gegenwart des Digitalen. Dass wir das Thema weiter verfolgen, versteht sich von selbst. So gibt es auch im Mai drei Essays, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf das Internet blicken. Günter Hack ist nicht nur einer der vielseitigsten Intellektuellen, die sich mit diesen Fragen befassen – er ist auch gelernter Schriftsetzer. (Von den großartigen Vogelvignetten, die er für uns regelmäßig verfasst, ganz zu schweigen.) Diese Fachkunde ist in seinem spannenden Text über die Entwicklung der Typografie hin zur Gegenwart des Responsive Design nicht zu übersehen. Daneben zeigt Michael Esders, wie im Netz Wörter und Sprache zum Gegenstand von Ranking- und Kapitalisierungsinteressen geworden sind. Und Max-Otto Baumann diagnostiziert ein weit reichendes Datenschutzversagen der deutschen Politik - dies ist der zweite online freigeschaltete Text aus dem Heft.
Der Überblick über das Maiheft findet sich hier.
Im Maiheft des Merkur nimmt Friedrich Wilhelm Graf kein Blatt vor den Mund: "Die beiden großen deutschen Volkskirchen sind nur noch erschreckend geistlose Organisationen."In Grafs Essay geht es dabei um ein schlagendes Beispiel: die strikte Ablehnung des ärztlich assistierten Suizids. Diese ist auch theologisch falsch, erklärt Graf, und warum das so ist, kann man nicht nur im Heft, sondern auch frei online nachlesen. Uns hat Grafs fundierter Furor so überzeugt, dass wir für ihn die Heftarchitektur umgestürzt haben: Was als Kolumne geplant war, ist nun der Aufmachertext.
Der 1996 verstorbene Philosoph Hans Blumenberg – der übrigens nie im Merkurveröffentlicht hat – hat postum weiter Hochkonjunktur. Auf einige Texte in jüngerer Zeit folgt ein Doppel, das weniger die Redaktion als der Zufall der Angebotslage gefügt hat. Birgit Recki, selbst Blumenberg-Schülerin, porträtiert den Denker und Lehrer so leidenschaftlich wie kenntnisreich. Im zweiten Artikel, einem Rezensionsessay, geht es um Blumenbergs zunächst positive, dann kritische Haltung zu Hannah Arendt; eine Entwicklung, die Hannes Bajohr auch anhand unveröffentlichter Dokumente aus dem Literaturarchiv in Marbach sehr präzise nachzeichnen kann. Spiel beste friv spiele auf der seite friv spiele jetzt.
Im Januar hatten wir einen Schwerpunkt zur Gegenwart des Digitalen. Dass wir das Thema weiter verfolgen, versteht sich von selbst. So gibt es auch im Mai drei Essays, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf das Internet blicken. Günter Hack ist nicht nur einer der vielseitigsten Intellektuellen, die sich mit diesen Fragen befassen – er ist auch gelernter Schriftsetzer. (Von den großartigen Vogelvignetten, die er für uns regelmäßig verfasst, ganz zu schweigen.) Diese Fachkunde ist in seinem spannenden Text über die Entwicklung der Typografie hin zur Gegenwart des Responsive Design nicht zu übersehen. Daneben zeigt Michael Esders, wie im Netz Wörter und Sprache zum Gegenstand von Ranking- und Kapitalisierungsinteressen geworden sind. Und Max-Otto Baumann diagnostiziert ein weit reichendes Datenschutzversagen der deutschen Politik - dies ist der zweite online freigeschaltete Text aus dem Heft.
Der Überblick über das Maiheft findet sich hier. -
Leserkommentar zu Ina Hartwigs „Reproduktionsmedizin als Metapher“
Ein Kommentar von Leser Manfred Schmidt zu Ina Hartwigs im Aprilheft erschienenem Beitrag Reproduktionsmedizin als Metapher.Klinische Unikate
Das, was sie tut, kam mir schon immer so vor wie das Wort, mit dem wir sie bezeichnen: Reproduktionsmedizin. Sachlich, semantisch genau, kein Euphemismus, wie wir ihn sonst gern verwenden, wenn wir Ungeheures bezeichnen wollen. Ich denke an Joysticks und Männer mit Mundschutz, an keimfreie Forschungslabore und das kalte Metall der Rechtsmedizin, an säuselnde Stimmen, die Wunschkinder und Elternglück versprechen. Das sind die ersten Bilder. Denkt man aber genauer darüber nach, dann ist dieses kühle Wort doch ein Euphemismus. Denn es geht ja gar nicht um die Vervielfachung, die Reproduktion eines Originals, sondern tatsächlich um die Schöpfung dieses Originals selber. Was wir Reproduktionsmedizin nennen, ist in Wirklichkeit also eine Produktionsmedizin, ein innovativer Zweig der medizinischen Forschung, der menschliche Unikate mit den Mitteln avancierter Biotechnologie erschafft; anders kann man es nicht nennen, wenn man die Sache nüchtern betrachtet. Aber kaum jemand tut das. Im April-Heft des Merkur analysiert die Literaturkritikerin Ina Hartwig Fotos von Susan Sontag und Annie Leibovitz' Tochter Sarah und schreibt dabei im Subtext eine seltsame Hymne auf die tröstenden Möglichkeiten jener Praxis des künstlichen Menschenmachens. Die Reproduktionsmedizin schließt sie kurz mit dem "euphorischen Möglichkeitsdenken vieler Amerikaner und vieler Homosexueller" und freut sich daran, dass diese Technologie "der Natur ein Schnippchen schlägt". (mehr …) -
Zum Tod von Günter Grass
Günter Grass, der heute gestorben ist, war im Merkur nur vier Mal vertreten, davon zweimal mit Vorabdrucken aus Romanen (einmal, 1958, zur Blechtrommel und einmal, 1976, zum Butt). Die Suche im Archiv ergibt aber den folgenden Fund einer sehr schönen Vignette, in der Helmut Heissenbüttel von einer Tagung der Gruppe 47 berichtet. (Der vollständige Text, der noch zwei mit dem dritten nicht direkt verbundene Teile enthält, ist im August 1965 erschienen und hier - kostenpflichtig - komplett lesbar.)
***
Helmut Heissenbüttel
Gruppenkritik
von 25 Autoren lasen 16 zum erstenmal 10 wurden positiv 9 negativ und 6 verschieden beurteilt in der Kritik fielen von 200 Wortmeldungen je 20 auf Walter Jens und Joachim Kaiser 17 auf Walter Höllerer 16 auf Erich Fried 12 auf Günter Graß 11 auf Hans Mayer 9 auf Marcel Reich- Ranicki je 7 auf Heinz von Cramer Fritz J. Raddatz und Peter Weiß 6 auf Erich Kuby je 5 auf Hans Magnus Enzensberger Alexander Kluge Jacov Lind und Hermann Piwitt 13 Kritiker sprachen je 4 mal und weniger Hermann Piwitt glaubt eine wirklich positive Geschichte gehört zu haben Günter Graß ist mit dieser Geschichte nicht so einverstanden Peter Rühmkorf unterscheidet einen blassen Erzähler Marcel Reich-Ranicki ist nur nicht im geringsten dafür daß die Grenze zwischen fiction und non-fiction verwischt wird Fritz J. Raddatz muß sich fragen was dem Thema nun Neues abgezwungen wird Walter Jens fragt sich in welcher Weise ein bestimmtes Milieu angemessen dargestellt werden kann also Heinz von Cramer findet das eine ganz besonders saubere Arbeit Joachim Kaiser sieht sich als Zeugen eines Manövers bei dem am Schluß das Gelände beinah leer ist Walter Höllerer sieht eine Metapher aus einem Familienbild heraustreten dann Pantomime werden und schließlich Kabinettstück Dieter Wellershoff erscheint das als Analogie zum Fertighausbau Roland H. Wiegenstein riecht eher eine schweißtreibende Modernität Reinhard Baumgart sieht eine furchtbare Art von Demokratie im Stil Günter Graß sieht reines Papier Hans Mayer geht die moralité daneben Walter Jens glaubt daß es gelungen ist Walter Höllerer fragt nach der Bezugsfigur und entdeckt die Relativität der Relationen als Prinzip es geht ihm um Daseinsformen und Bewußtseinsmöglichkeiten Walter Jens hat von Walter Höllerers Rede nichts verstanden Hans Magnus Enzensberger gesteht daß er beim Zuhören etwas geschwankt hat Marcel Reich-Ranicki kann nicht recht verstehn was Hans Magnus Enzensberger gesagt hat und befürchtet durchaus den Schritt vom Asketischen zum Sterilen er hat wenig dagegen nichts dafür zu sagen Hans Mayer hat Walter Höllerer eigentlich durchaus verstanden und beim Hören die merkwürdigsten Evolutionen durchgemacht Joachim Kaiser wendet sich gegen das Wort steckenbleiben von Walter Höllerer Walter Mannzen weiß nicht ob Günter Graß weiß ob Brecht wissen konnte was Graß weiß und Unseld wissen kann was Brecht wußte und Graß weiß ob Brecht wissen konnte ob Unseld weiß was Graß nicht weiß aber er sagts auch nicht Walter Höllerer findet sehr viel an subtiler Substanz Walter Jens findet weder Theologie noch Libretto Alexander Kluge findet eine sehr interessante Abkehr von der Rhetorik Günter Graß findet das nun einmal eine pausbäckige Angelegenheit Hans Mayer findet den Text sehr schön. Günter Graß kommt es auf den langen Atem an Marcel Reich-Ranicki will nur nicht gleich aufhören zu kritisieren wenn es sich nicht um avantgardistische Kunststücke handelt Hans Mayer findet es schwer etwas zu sagen er ist sehr bewegt und findets wunderschön Joachim Kaiser hat keinen Kunstfehler entdeckt Hans Werner Richter wundert sich über sich selbst -
Der komplette Merkur für 48 Euro
Ab sofort gibt es ein neues, extrem günstiges Online-Abomodell für den Merkur: Das komplette Heft, inklusive Zugriff auf das digitale Archiv (zurück bis 1947) für 48 Euro im Jahr. Es handelt sich dabei um ein "Abo für den akademischen Nachwuchs". Das soll heißen: Es gilt nicht nur für Studierende, sondern auch für Doktoranden, Postdoktoranden und befristet in Projekten oder an der Universität Angestellte. (Die Ironie der Rede vom "Nachwuchs" liegt dabei in der Situation der Betroffenen, nicht im Namen für das Abo.) Haken gibt es keine, auch keine Hinterhältigkeiten im Kleingedruckten. en.escortbayan.xxx/ankara Für alles weitere - auch die Möglichkeit zum direkten Abonnieren - hier entlang. -
Zum 1. April
Das Aprilheft ist da. Claus Pias unternimmt es darin, aus sympathetischer Sicht Friedrich Kittlers höchst folgenträchtigen Hack der Germanistik zu historisieren. (Der Text ist eine der beiden frei lesbaren Proben aus diesem Heft.) Sogar noch weiter zurück als der Titel verspricht, geht es in Boheme vor und nach '68 von Walburga Hülk, Nicole Pöppel und Georg Stanitzek - oder wenigstens geht es bis 1800 und zum Philister als Schreckbild zurück. Daran schließt zwanglos Hannelore Schlaffers Essay an, denn darin geht es um Philister, Spießer und Schwaben (auch er ist online zu haben). Außerdem unter anderem: Eckhard Nordhofen lotet das fundamentalistische Potenzial der Grapholatrie in Christentum und Islam aus. Bilder vom Körper Susan Sontags analysiert Ina Hartwig. In den Kolumnen geht es um Konzentrationslageraufnahmen und um den unterschiedlichen Umgang mit faschistischem Architekturerbe in Deutschland und Italien. Andreas Eckert schreibt über gewisse Revisionen des Heldenbilds von Ryszard Kapuściński. Die Schlusstrias im April: Bernd-Peter Lange stellt Walter Benjamin und Bertolt Brecht als Schachspieler vor. Günter Hack nähert sich dem Rotschwanz mit (nicht nur) Adalbert Stifter. Und Stephan Herczeg tut im Journal erst nichts, und dann doch was. Und dann noch die kurze Werbeeinblendung: Wir haben jetzt ein Online-Abo-Angebot, das der akademische Nachwuchs nicht ablehnen kann - den kompletten Merkur für 48 Euro im Jahr. Näheres hier. -
Noch einmal zum Relaunch
Am Mittwoch, den 11. März nahm die Sendung "Lesart" die optische Runderneuerung des Merkur und der "Akzente" zum Anlass für ein Interview mit Merkur-Herausgeber Christian Demand und Clemens Setz, der gemeinsam mit Hanser-Chef Jo Lendle das erste neue Heft der "Akzente" konzipiert hat. Hier geht es zum Link des Beitrags im Onlinearchiv von Deutschlandradio Kultur. https://buyiglikesfast.com/buy-instagram-likes/ -
Februarheft
Wir drucken keine Laudationes, und Dankreden auch nicht. Es sei denn, sie sind so großartig wie Navid Kermanis Rede, die er zu Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises hielt. Zumal er darin ganz anderes tut, als einfach zu danken. Vielmehr handelt es sich um eine Art Fortsetzung des Totenbuch-Motivs seines großen Romans Dein Name, für den er die Auszeichnung in erster Linie erhielt: In fünf Nachrufen porträtiert er ihm wichtige Menschen, die seit Vollendung des Buches verstarben, von Heinz Ludwig Arnold über den ehemaligen Rektor seiner Schule bis zu Frank Schirrmacher, der Kermani erst förderte und dann mit Verachtung strafte. Auch nicht alltäglich: ein Gedicht, noch dazu ein von Ror Wolf und Gerhard Henschel gemeinsam im Email-Pingpong verfasstes. Außerdem ein Essay über das Hören, das Zuhören und die Möblierung des Raums mit Musik von Thomas Steinfeld. Ebenfalls musikalisch: Andreas Dorschel, der die Ästhetik und insbesondere die erfolgreiche Wiederbelebung des Fado in jüngerer Zeit erklärt. Kritische Anmerkungen zum Selbstverständnis des Journalismus am Beispiel des Spiegel (genauer: eines Gesprächs mit Renate und Klaus Harpprecht) hat Matthias Dell in seiner Medienkolumne. Gratis online, wie schon vermeldet, Alban Werners vergleichende Analyse von Grünen und AfD - sowie Ute Sacksofskys Rechtskolumne zum Thema Glaubensfreiheit. Ergänzend dazu im Blog: ihre Antworten auf drei Nachfragen von unserer Seite. Hier die Übersicht mit Zitaten aus allen Texten sowie diversen digitalen und Print-Kaufmöglichkeiten. -
Nachgefragt: Ute Sacksofsky zu ihrer Rechtskolumne zur Glaubensfreiheit
In ihrer Rechtskolumne im Februarheft (hier bis Ende des Monats frei lesbar) setzt sich Ute Sacksofsky kritisch mit jüngeren Urteilen zur Glaubensfreiheit auseinander. Wir sahen an manchen Stellen Klärungsbedarf - und haben deshalb per Mail drei Zusatzfragen gestellt. *** Merkur: In Ihrer Kolumne rekapitulieren Sie, dass das Recht auf Glaubensfreiheit in Deutschland nach gängigem Rechtsverständnis die Freiheit beinhaltet, „sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln“. Zugleich beklagen Sie, dass dieses Recht nicht für alle Gläubigen in gleicher Weise gilt. Fundamentalistische Minderheiten etwa, können vor deutschen Gerichten in der Regel mit weniger Entgegenkommen rechnen als Angehörige der großen Kirchen. Täuscht der Eindruck, oder liegt dieser Ungleichbehandlung eine stillschweigende Unterscheidung zwischen (legitimer) Religionsgemeinschaft und (illegitimer) Sekte zugrunde? Ist denn eine solche Unterscheidung überhaupt eine juridisch belastbare Kategorie? Und falls nicht: Wie kann dann zwischen berechtigten und unberechtigten Berufungen auf das Recht auf Glaubensfreiheit unterschieden werden? Ute Sacksofsky: Dies ist in der Tat der zentrale Punkt meiner Kolumne: Eine Unterscheidung zwischen (legitimer) Religionsgemeinschaft und (illegitimer) Sekte verkennt den fundamentalen Gehalt der Glaubensfreiheit. Die Glaubensfreiheit überlässt es den Einzelnen zu entscheiden, welcher Religion sie angehören möchten, und zwar auch, welcher konkreten Ausprägung einer Religion. Umgekehrt formuliert: Dem Staat ist es untersagt, Religionen inhaltlich zu bewerten. Der Staat darf nicht die eine Religion für "gut", die andere für "schlecht" befinden; dementsprechend "gehört" tatsächlich jede Religion zu Deutschland. Die grundsätzliche Prüfung, ob sich eine Berufung auf die Glaubensfreiheit durchzusetzen vermag, hängt davon ab, ob die Gründe ausreichen, die zur Beschränkung der Glaubensfreiheit angeführt werden. Hier anerkennt die Verfassung nur solche Gründe, die ihrerseits eine verfassungsrechtliche Basis haben und zudem hinreichend gewichtig sind. Gibt es solche Gründe nicht, setzt sich die Glaubensfreiheit von Sekten-Mitgliedern genauso durch wie die von Anhängern des religiösen Mainstream. Dass die Gerichte dies teilweise anders handhaben und sich bei Anhängern kleinerer religiöser Strömungen mit weniger guten Gründen zufrieden geben, ist nicht akzeptabel. (mehr …)