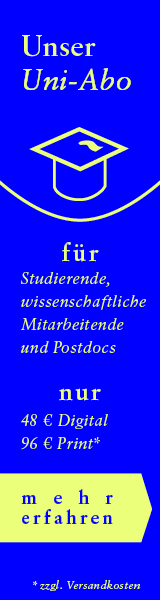Author: Danilo Scholz
Artikel Author: Danilo Scholz
-
Pour Rainald Goetz
Es könnten durchaus 300 Croissants sein, die ich mittlerweile bei Pierre Hermé gegessen habe. Anlass ist der Besuch im V. und VI. Arrondissement. Dort ist die Uni, also Arbeit. Man muss es sich schön machen, weil diese Pariser Stadtteile nicht schön sind. Man sieht vor allem Studenten, Reiche und Alte. Es ist die Zone der schiefgegangenen Schönheitsoperationen. Nur manchmal, wenn ich am Panthéon vorbeigehe, bin ich eingeschüchtert und muss lächeln. Das Panthéon will natürlich einschüchtern, schließlich werden dort diejenigen aufgebahrt, denen die wohl einzige Unsterblichkeit, die Sinn macht, beschieden ist, die republikanische nämlich. Rousseau wusste, dass es eine Zivilreligion braucht, Robespierre träumte gleich vom "culte de l’Être suprême". Bevölkert wird der republikanische Himmel überwiegend von Männern. Dieser Olymp ist ein ziemlicher Sackhaarberg. Sonst wüsste ich aber nicht, warum man sich im V. oder VI. Arrondissement aufhalten sollte. Nur manchmal kommt Tilman Krause von der Welt und ist traurig, dass Paris auch nicht mehr das ist, was es mal war. Noch immer gibt es viele Leute aus der Modebranche, die englischen Zeitungen ihr Paris zeigen wollen und den Lesern empfehlen, unbedingt ins Café de Flore oder ins danebenliegende Les Deux Magots zu gehen. Diesen Leuten sage ich: Ich will Euch nicht pathologisieren, aber ihr seid krank. (mehr …) -
Indigene Stammeskulturen
Vor kurzem stellte Giuseppe Bianco in Paris sein Buch Après Bergson. Portrait de groupe avec philosophe vor. Es wird, davon ist auszugehen, die Art und Weise ändern, wie in Frankreich über die Rezeption und Aneignung von Bergsons Denken gesprochen wird. Aber diese Veränderungen brauchen Zeit. Im Augenblick staune ich noch über Giuseppes neuen Look, während er seine Recherchen dem Publikum im Saal erläutert. Die Haare sind länger geworden und werden jetzt nach hinten gegelt. Ich weiß gar nicht, wie man die Farbe seines Hemdes nennen sollte: ein ganz blasses Pink, eigentlich fast schon weiß. Steht ihm. Später will ich wissen, woher er es hat, Acne, A.P.C., Sandro? Er schaut etwas erstaunt, weist derartige Unterstellungen zurück und antwortet: Zara. Nach der Präsentation gab es einen kleinen Empfang im Untergeschoss der philosophischen Fakultät der École normale supérieure. Es ist eine Art Aufenthaltsraum. Ich bin froh, dass sich die Tür zum Hof nach zwei Versuchen recht leicht öffnen lässt. Den französischen Unis, selbst den grandes écoles, fehlt es an Geld. Die Canapés werden zwar kleiner, aber das Essen deshalb nicht schlechter. Und es wird immer rosbif geben, dazu wird Estragonmayonnaise serviert, Weinflaschen werden geöffnet. Ich stehe eine Stunde am Buffet, esse still vor mich hin und bin zufrieden. (mehr …) -
François Maspero (1932-2015)
“Évidemment, tout le problème réside dans la forme d’écho qu’on peut être”
Die Geschichte der Intellektuellen in der Bundesrepublik ließe sich als eine Geschichte der Kindernazis und Nazikinder schreiben. Das geistige Leben in Frankreich hingegen stand gerade in den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ganz im Zeichen der Résistance. Oft war das ein Gestus der Revolte, der mit der historischen Wirklichkeit der Kollaboration wenig zu tun hatte. Bei François Maspero war es Familiengeschichte. Seine Eltern wurden von der Gestapo verhaftet. Sein Vater, ein Sinologe und Professor am Collège de France, kommt in Buchenwald um, seine Mutter entgeht dort nur knapp dem Tod. Sein älterer Bruder Jean stirbt 1944, er hatte sich nach der Landung der Alliierten auch den amerikanischen Invasionstruppen angeschlossen. Maspero wollte den Nazis nicht das letzte Wort über die Erinnerung an seine Familie überlassen. Wenn ich lese, was er diesbezüglich zu Protokoll gab, muss ich an Tarantinos Inglorious Basterds denken: "Ich bin sehr stolz darauf, dass mein Bruder mit 19 schon drei deutsche Offiziere auf offener Straße erschossen hatte." Jean, ein Heckenschütze der Résistance, wurde keine 20. Er betrachtete den Tag, an dem sein Bruder starb, als sein eigentliches Geburtsdatum. Es war die Geburt "zum Tod", so Maspero später. Doch zuvor muss man leben. Noch bevor François Maspero als Verleger bekannt wurde, war er als Buchhändler tätig. Sein Ethnologiestudium hatte er abgebrochen. Er eröffnete "La Joie de lire" 1955, ein Buchladen, den er von einem ehemaligen Anhänger Pétains übernommen hatte. Entsetzt über das Verhalten des französischen Staates im Algerienkrieg, steigt er 1959 auch in das Verlagswesen ein. Der Maspero-Verlag veröffentlichte Pamphlete des Kriegsgegners: Die führenden Köpfe der algerischen Befreiungsbewegung FLN kamen zu Wort. Dazu kamen Texte, in denen es immer um die systematische Folterpraxis der französischen Armee ging. Andere richteten sich an französische Soldaten und ermunterten sie zur Fahnenflucht. Nicht weniger als 13 Bücher wurden allein zwischen 1960 und 1962 von der Justiz verboten. (mehr …) -
Das deutsche Europa im Spiegel
Der Spiegel auf Englisch, ein Problem der Sprache. Dazu kommt: The Spiegel style doesn’t travel well. Das Nüchtern-Verstockt-De-Facto-Hafte* (aber immer dicht dran an den Menschen) wirkt im Englischen noch seltsamer. Luftballons der Ernsthaftigkeit steigen aus diesen aufgepumpten Texten auf und eigentlich möchte man sie als Leser der Reihe nach zum Platzen bringen. Tut man natürlich nicht. Viel zu schnell gerät man in den Sog der Artikel, denn das Problem erweist sich ja bei genauerem Hinsehen als große Stärke und eigentliches Erkennungszeichen des Spiegels: absolute Distanzlosigkeit gegenüber der Wirklichkeit. Ich lese die englischen Sachen schon allein deshalb, weil sie die größeren Geschichten aus dem Heft, auch die Titelstory, online kostenlos verfügbar machen. Die englische Spiegel-Online-Seite könnte ein internationales Aushängeschild sein, aber man zögert, die Artikel zu teilen. Es gibt da zu viele hölzerne und peinliche Sätze ("Since 2010, the ECB has had little resemblance more to the Bundesbank…"; "With the selection of his coalition partner, Tsipras has charted a course…"). Manchmal kamen Rückfragen: Who translated that? Journalisten lesen die großen internationalen Tageszeitungen. Als Adressat des eigenen Schreibens tauchen sie allerdings höchst selten auf. Man liest international, schreibt aber national. Auf Spiegel Online finden sich zwar regemäßig Pressereaktionen aus dem Ausland, aber irgendwie verpufft das ohne jeden Effekt. Da war der Internationale Frühschoppen in den fünfziger Jahren schon weiter. Klar, es gibt eine Leserschaft und die ist deutsch. Aber ich finde es hochgradig verstörend, mit welcher Selbstverständlichkeit mancher Leitartikel über die Dummheit der Argumente und die Provinzialität der geistigen Welt der Pegida-Demonstranten herzog, obwohl Journalisten sich doch selbst oft genug mit teutonischen Verengungen zufriedengeben. Mehr Welt reinlassen: Diese Forderung sollte immer reflexiv sein, sie richtet sich an das eigene Ich. (mehr …) -
Risiko und Verantwortung am Collège de France
Das New Yorker Department of Financial Services, eine US-Regulierungsbehörde, geht einem Bericht der Financial Times zufolge jetzt doch noch einmal dem Manipulationsverdacht auf den Devisenmärkten nach. Viele der Banken mussten bereits hohe Geldstrafen zahlen, weil Devisenhändler Absprachen trafen, um die Wechselkurse zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Auf Seiten der Banken reagierte man empört auf das Verhalten der "rogue traders" in den eigenen Reihen. Jetzt kommt allerdings ans Licht, dass nicht nur einzelne Personen versuchten den Wechselkurs zu beeinflussen, sondern bankenweit Algorithmen zum Einsatz kamen. Interessanterweise wird das möglicherweise noch weitaus höhere Geldbußen zur Folge haben. Die Codes, die verwendet wurden, lassen das Problem nämlich unzweifelhaft als ein systemisches erscheinen. Es ist, als ob die Kybernetik sich gegen ihre Anwender richtet. Norbert Wiener hat die Kybernetik einst als "Wissenschaft von der Steuerung und Regelung, das heißt der zielgerichteten Beeinflussung von Systemen" definiert. Das wird den Banken gerade zum Verhängnis. (mehr …) -
„That’s My Hood“: Bei Westbam zuhause
Schon vorletzte Woche machte Stuckrads Homestory alles richtig. Da war Katja Ebstein zu Gast in der Sendung, deren Prinzip ganz einfach ist: Benjamin von Stuckrad-Barre trifft Leute, weiß aber vorher nicht wen. Leider hat Ulf Poschardt einfach so lange behauptet, das deutsche Boot sei voll mit humorlosen, lustfeindlichen, protestantischen Ex-68ern, die längst zu rot-grünen Spießbürgern verkommen sind, dass es irgendwann für plausibel gehalten wurde. Dieses falsche Bild wird von Katja Ebstein einmal komplett auseinander genommen. Im Gespräch mit Stuckrad-Barre ist sie so offen, selbstironisch und berichtet mit beinahe buddhistischer Lässigkeit aus ihrem Leben. Auch das war 68. Ich fand’s großartig. Diese Woche legt die Sendung noch eine Schippe drauf, was ich fast nicht für möglich gehalten habe. Besuch bei Westbam. Gleich zu Beginn wird ein Einspieler aus Westbams Kokszeit Anfang der neunziger Jahre gezeigt. Schweiß auf der Stirn, Redeschwall, der ganze Pipapo. Stuckrad machte ähnliche Erfahrungen mit der Droge. Seine Kokainabhängigkeit war sogar Gegenstand einer Doku, die ich mir allerdings bis heute nicht angesehen hab. (Kommt noch.) Ich kannte nur Rainald Goetz’ obsessive Auseinandersetzung mit der Persona Stuckrad-Barres, also mit der Art und Weise, wie seine persönlichen Hochs und Tiefs von Stuckrad selbst in den medialen Raum eingespeist werden. Die Texte waren so schön, weil es nie darum ging, die Massenmedien einmal im Kreis durch die kulturkritische Manege zu führen. Viel eher waren es Bausteine für eine neue Theorie des Boulevards, die da weitermachten, wo Les Stars, das 1957 erschienene Buch des französischen Philosophen Edgar Morin, aufgehört hatte. (mehr …) -
Spread Your Word Like a Fever
Manche Zeitungsartikel beschwören Bedrohungen, um sie umso besser bannen zu können. Gerade die Zeit steht für eine Entwicklung, in der der Journalismus zunehmend zu einer Agentur der symbolischen Immunisierung wird, wie Sloterdijk diese Zielvorgabe mal genannt hat. Nicht Neugier, sondern das Bedürfnis nach Absicherung ist die treibende Kraft. Als Mittel dient den Texten oft ein dramatisches Setup. So inszenieren Amrai Coen und Malte Henk in ihrer ausführlichen Ebola-Reportage vom 6. November 2014 einen Showdown zwischen Mensch und Virus. Von Beginn an lässt der Text keinen Zweifel daran, dass es ihm vor allem darum geht, die Identität des Gegenübers genau zu bestimmen. Womit hat man es überhaupt zu tun, einem "Feind? Einer Naturgewalt? Einer unsichtbaren, ungreifbaren Gefahr?". Reporter wollen so nahe am Menschen sein, dass sie sich über die begrifflichen Verstrickungen des eigenen Schreibens nicht genug Gedanken machen. So nahe am Menschen, dass selbst das Virus gnadenlos anthropomorphisiert und somit textlich handhabbar gemacht wird. Im Epilog erkennt man zwar an, dass ein Virus nur eins "will": existieren. Aber derartige Details aus der Biologie wollen nicht recht in die Spannungskurve passen. Man muss sich das Virus nämlich, wenn nicht als glücklichen Menschen, so doch als "Massenmörder" vorstellen, der mitunter einem Tier ähnelt. (mehr …)