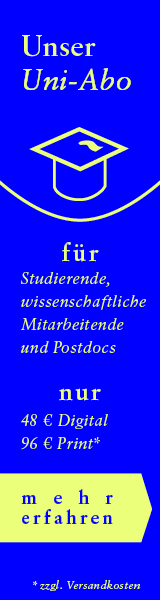Wie der (west)deutsche Film jung wurde
Im Januar 1960 kam Fritz Lang nach Berlin. Er war zu dem Zeitpunkt siebzig Jahre alt und längst eine Legende, als einer der großen Regisseure der Weimarer Jahre, der Deutschland wegen der Nazis verlassen und in Hollywood reüssiert hatte. Allerdings war er dort zu dem Zeitpunkt seit einigen Jahren nicht mehr besonders gefragt. Darum hatte er Artur Brauners Angebot angenommen, für dessen Produktionsfirma in den CCC-Studios in Spandau noch einmal Abenteuerfilme zu drehen. (mehr …)
Abgesänge. Popkolumne
Auf die Frage, was eigentlich die kleinste Einheit von Pop ist, gibt es einige interessante Antworten: eine Geste, ein Geräusch, ein Laut, ein Sound und manch anderes mehr. Welche man für die überzeugendste hält, hängt davon ab, aus welchem Winkel man gerade auf das Phänomen blickt. Hohe Plausibilität genießt im Nachdenken über Popmusik spätestens seit den siebziger Jahren der soziologische Blick, also die Interpretation der Zeichen des Pop als gesellschaftsanalytisch aussagekräftige Entscheidungen. (mehr …)
Tiefe Eindrücke
Charisma ist, ähnlich wie Pornografie, leicht zu erkennen, aber schwer zu definieren. Der (hier verkürzt zitierte) Definitionsversuch von Max Weber grenzt an eine Tautologie: »›Charisma‹ soll eine als außeralltäglich geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen Kräften oder Eigenschaften begabt gewertet wird.« Die Sozialwissenschaft kam auch später nicht viel weiter – obwohl Karriere-Coaches und Berater von Managern immer noch versuchen, Charisma auf Aspekte herunterzubrechen, die man sich aneignen könnte. (mehr …)
Das Kursbuch der Deutschen Bundesbahn
Ich sitze im Walhalla mit David beim Bier. Ich will schon lange über das Bundesbahn-Kursbuch schreiben, habe aber keinen Aufhänger. Bloß darstellen, wie kurios diese Fahrpläne früher aussahen? Da erwähne ich, dass es noch bis in die 1980er Jahre hinein selbst auf Hauptstrecken mehrstündige Löcher im Fahrplan gegeben hat. Zwei bis drei Stunden kein Schnell- oder Eilzug, sechs Stunden kein Nahverkehrszug, durchaus normal. Das ist ihm neu. Und plötzlich weiß ich, wie ich es angehen kann – und warum! (mehr …)
Geheime Spuren
Dass sich Technikgeschichte vor allem für das Entstehen neuer Technologien interessiert, muss man ihr nicht zum Vorwurf machen – schließlich führt die Frage nach der Technikgenese fast zwangsläufig auch zur viel unbequemeren Frage, was denn vom Neuen verdrängt worden ist. Die Produktion von technischen Einrichtungen ist auf fatale Weise an das mehr oder weniger sanfte Verschwinden von Geräten und vertrauten Verfahren gekoppelt. Ob das auch für Apparaturen des Geheimen gilt? (mehr …)
Warum Lueger fallen muss
2020 war das Jahr der attackierten Statuen. Im Zuge eines neuen identitätspolitischen Antirassismus entdeckten Aktivisten die Schattenseiten der Heroen auf den Sockeln westlicher Städte. Das führte zu Szenen, wie sie der zeitgeschichtlichen Erinnerung aus Osteuropa nach dem Untergang der Sowjetunion oder aus dem Irak nach der US-Invasion geläufig sind: In Bristol brachten wütende Demonstranten die Statue des Philanthropen und Sklavenhändlers Edward Colston (1636 bis 1721) zu Fall und warfen sie ins Hafenbecken – der Auftakt zu europaweiten Appellen, auch unzähligen weiteren Rassisten und Kolonialisten aus Stein und Bronze den Garaus zu machen. (mehr …)
Kritik und Krawall
Präsident Biden sei Amerikas »biggest asshole«. So hat sich vor einiger Zeit ein prominenter Landsmann öffentlich geäußert – jemand, den man (sprachlich) überall, nur nicht in der Gosse vermutet hätte.1 Wer allerdings der Hoffnung war, diesen ungenierten Ehrabschneider werde deshalb irgendein Bannstrahl treffen, sah sich getäuscht. Kein Anwalt ist in die Spur gegangen, weder von Staats noch Rechts wegen. (mehr …)
Mein Sommer mit Kennedy
An dem Tag, an dem John F. Kennedy nach Deutschland kam, begann ich ein Tagebuch zu führen. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, ob überhaupt, vermag ich nicht mehr zu sagen. Ich hatte offenbar die Idee, dass es später einmal interessant sein könnte, was in meinem jungen Leben passiert. (mehr …)
Koloniale Währungen: Medium der Macht
Wann und wie werden Schulden zu Macht? Diese Frage stellt sich von Beginn an, sobald das Medium, in dem Schulden festgehalten und beglichen werden – das Geld – in den Blick genommen wird. Wer definiert die Einheit, in der die Schulden notiert werden, wer kalibriert deren Maß gegenüber anderen Einheiten, und wer kontrolliert die Schöpfung der zur Schuldentilgung verwendeten Zahlungsmittel? Dies ist eine Frage der Souveränität.
„Wenn der Selbstmord erlaubt ist…“
"Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.«1
(mehr …)