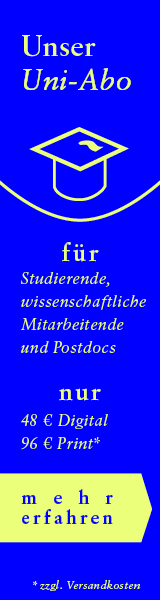-
Dezember 01, 2016 - Keine Kommentare
Peter Sloterdijk hat einen Roman geschrieben, ganz ohne Not, und auch nicht zum ersten Mal (siehe den Zauberbaum aus dem Jahr 1987, ein Auszug daraus war im übrigen sein letzter von zwei Auftritten im Merkur): Das Schelling-Projekt erzählt in E-Mail-Wechseln von einem (scheiternden) Projektantrag bei der DFG - es soll darum gehen, wie mit dem weiblichen Orgasmus der Geist in die Materie fuhr. Es ist im Roman allerdings so, dass sich für diese Frage vornehmlich forschende Männer (Peer Sloterdijk, Guido Mösenlechzner, Kurt Silbe) zuständig fühlen; ihre weiblichen Konterparts (Beatrice Freygel, Desiree zur Lippe) berichten beispielsweise von sexueller Erweckung mittels Gangbang. Für Eva Geulen und Hanna Engelmeier der Anlass, ihrerseits einen E-Mail-Wechsel zu beginnen, genau einen Monat lang, vom 8. Oktober bis zum 8. November, dem Tag der Trump-Wahl. Sloterdijks Roman war, wie sich zeigte, mehr Anlass für ein digressives Duett - einen schriftlichen Dialog darüber, welche Assoziationen zum Roman wie weit tragen. So geht es nun unter anderem um Autobiografien von (emeritierten) Professoren, um Machtpositionen im akademischen Betrieb, um Heinz Strunk, die Buchmesse und den Kritiker-Empfang des Suhrkamp Verlags bei der Frankfurter Buchmesse. Das Ganze war eine bei einer Zufallsbegegnung von Hanna Engelmeier und Eva Geulen spontan geborene Idee - da der Merkur (bzw. Ekkehard Knörer) dabei ebenfalls anwesend war, erscheint das Ergebnis nun hier, und zwar in drei Teilen. Hier ist der erste Teil, er umfasst den Zeitraum vom 8. bis zum 20. Oktober. Den zweiten Teil können Sie hier lesen. Und den dritten jetzt hier.
(mehr …) -
Mai 23, 2016 - Keine Kommentare
Nachricht von Peter Praschl an Ekkehard Knörer: Sag Hanna, dass sie sich nicht über Wien lustig machen, sondern dass sie es verabscheuen soll. Kurzform einer Nachricht an Peter Praschl: Das will ich nicht. Nachricht von Peter Praschl: Du sollst es aber verachten, dieses Faschistennest. Der Austausch kommt zu einem guten Ende. Wir schicken Küsse von Berlin nach Wien und retour.
Während am 22. Mai die Wahllokale öffnen, schwimme ich das erste Mal in diesem Jahr draußen, im Jörgerbad. Der Freibadbereich ist nur so groß wie ein etwas überdimensionierter Privatgarten, mitten zwischen die Altbauten geklatscht. Aus den Fenstern kann man vermutlich selbst von hoch oben noch die kleinsten Dinge erkennen. Alles ist schön und voller Hoffnung an diesem Morgen, die Sonne und die Vögel und die warme Luft und meine Schulter, die nicht mehr weh tut und das Knie, das nicht mehr zieht, und man könnte auch noch was über die Körpermitte sagen. (mehr …) -
Mai 02, 2016 - Keine Kommentare
Zum Prokrastinieren steht neben meinem Büro die Bibliothek des Forschungszentrums bereit, unter anderem lagern dort Stapel der New York Review of Books, darin las ich dieser Tage eine Rezension von Liz Garbus’ Film What happened Miss Simone, der wie die Rezension mit einem Ausschnitt aus einem Interview beginnt, das ein Reporter des öffentlichen Fernsehens New York 1968 mit Simone führte. Er fragt: „What’s ‚free’ to you?“ und sie antwortet unter anderem: „It’s just a feeling – it’s like how do you tell somebody how it feels to be in love – how do you tell anybody who’s not been in love what it’s like to be in love? You can not do it to save your life.“ Liebe ist eine Live-Veranstaltung, aber das gilt nicht umgekehrt, darum geht es hier. (mehr …) -
April 13, 2016 - Keine Kommentare
Emmanuel Carrère sitzt in einem Bergdorf im Wallis und guckt Internetpornos. In seinem Buch Das Reich Gottes beschreibt Carrère dann weiter, wie er ein Lesezeichen für ein Video anlegt, das er wahnsinnig heiß findet, weil die darin gezeigt Brünette, die sich selbst befriedigt, „sexuell gesehen die Quintessenz ‚meines [seines] Typs’“ ist. Ich dagegen lege ein Lesezeichen für eine Abbildung von Rogier van der Weydens Gemälde an, das zeigt, wie der heilige Lukas die Muttergottes malt. Es gibt zu dem Gemälde viel zu sagen, allerdings nicht von mir, ich bin bloß Fan dieses seltsamen Raums und der Brust der Madonna und der Aussicht durch das Seitenfenster und des zufrieden trinkenden Jesuskindes, ansonsten bin ich ahnungslos, es wurde zu dem Gemälde auch schon viel gesagt (so stellt sich die Forschung gerne die Frage, ob diese Madonna einer Person ähnelt, die wirklich gelebt hat). Unter anderem eben von Carrère, der das Bild mit seinen Pornografiestudien zur Quintessenz seines Typs in Zusammenhang bringt: (mehr …) -
März 18, 2016 - Keine Kommentare
Die Aufgabe lautet: Ankunft im Wiener Musenkloster am 1. März, um 10 Uhr, Beziehen des Büros, abends Empfang, bis dahin erste Übungen in freier intellektueller Entfaltung. Ich richte Twitter und Online-Banking als Lesezeichen im Browser ein und formuliere eine Abwesenheitsnachricht für die Heim-Mailadresse: Forschungsaufenthalt, dauert länger, schönes Leben noch. Dann lese ich im Standard, der vor der Universität Wien regelmäßig kostenlos ausgeteilt wird, in der Hoffnung, dass Studierende, die eine Zeitung gratis nachgeschmissen kriegen, irgendwann zu zahlenden Abonnenten werden. Auf der ersten Seite wird berichtet, dass der „umstrittene Mediziner“ Marcus Franz (ÖVP) einem Ausschlussverfahren seiner Partei durch Austritt zuvorkommt. Er hatte öffentlich Vermutungen darüber angestellt, dass Angela Merkel deshalb so viele junge Flüchtlinge nach Deutschland einlasse, um die eigene Kinderlosigkeit auszugleichen. Ich habe Marcus Franz nun mit Bildersuche gegoogelt und möchte öffentlich Vermutungen darüber anstellen, dass er Mitglied im Fitness-Club John Harris am Schillerplatz ist, oder aber eine Vielzahl von Brüdern und Cousins hat, die ihm sehr ähnlich sind und dort die Zeit nach Feierabend verbringen. (mehr …) -
Oktober 06, 2015 - 1 Kommentar
Karl Ove Knausgård ist momentan der bekannteste Autor Norwegens. Das gilt in mindestens Norwegen, den USA und in Deutschland. Das ist einer der Gründe dafür, dass am vergangenen Freitag ungefähr 800 Leute in das Haus der Berliner Festspiele gekommen sind, um einen "Tag mit…Karl Ove Knausgård" zu verbringen, der von 19.30 bis ca. 0.30h dauerte, was eine interessante Verkürzung ist, aber Knausgårds autobiographische Min Kamp-Romanreihe, die hier gefeiert wurde, schildert ja auch nur ca. die ersten 40 Jahre seines Lebens, die dafür in großer Ausführlichkeit. Aufgeteilt war der Abend in einen Prolog, ein Gespräch mit dem Autor und eine Late Night mit Musik, dazwischen Signierstunde, Rotwein, Toilette, Zigarette (je nach Bedarf).
An diesem Abend zeigte sich unter anderem, dass man offenbar bei einem monumentalen Unternehmen dichterischer Selbstbespiegelung vor allem viel Zeit braucht um zu zeigen, was daran so toll ist; die schiere Menge an Text, die Knausgård produziert hat, dürfte es nicht sein, auch andere Autoren (weniger: Autorinnen) schreiben 1000-seitige Bücher. Ein besonderes poetisches Verfahren ist es auch nicht, denn Knausgård beschäftige sich vor allem mit dem Problem der literarischen Epigonalität, wie Ijoma Mangold (Die Zeit) sagte, der im ersten Teil des Abends mit dem Knausgård-Übersetzer Paul Berf und dem Moderator Thomas Böhm einen "Prolog" führte. (mehr …) -
September 19, 2015 - Keine Kommentare
Karl Ove Knausgård stellt eine Frage: „Welchen Sinn sollte es haben, ein mittelmäßiger Literaturwissenschaftler zu sein?“ Auf Seite 397 von Träumen befindet sich Knausgård mitten im Literaturstudium in Bergen. Er hat eine Klausur zu Dantes Göttlicher Komödie geschrieben und entdeckt auf dem Schwarzen Brett des Instituts, dass sie mit einer 2,4 benotet wurde. Da sich Knausgård selbst für alles andere als einen Zweierschüler (aber für einen Dante-Kenner) hält, beantwortet er die Frage selbst so: „Das war doch vollkommen sinnlos.“
Träumen ist der fünfte und vorletzte Band von Knausgårds autobiographischem Projekt Min Kamp, und diese Szene findet sich ungefähr in der Mitte des Buches, das anders als die vorangegangenen Teile nicht zwischen Knausgårds Kindheit und seinem Erwachsenenleben hin- und herspringt, sondern chronologisch dem Zeitpunkt entgegengeht, an dem Knausgård als Autor etabliert ist und Bergen verlässt. Die Erzählung gliedert sich in zwei Teile: Wir begleiten KOK an die Akademie für Schriftsteller, wo er sich durch ein Jahr mit wenig Anerkennung für seine Schreibversuche und viel Liebeskummer quält, aus dem ihn erst seine Freundin Gunvor erlöst, die Ponys und Waffeln, Bücher aber weniger mag. Ihr zuliebe verbringt er ein Jahr auf Island, duscht in schwefeligem Wasser, versucht weiter zu schreiben. Er kehrt zurück nach Bergen, schläft mit einer anderen Frau, studiert weiter Literaturwissenschaft, arbeitet in einer Einrichtung für psychische Kranke und beim Campusradio, lernt seine erste Ehefrau kennen, verbringt Zeit in England, hat langsam Erfolg mit seinen Texten, kämpft mit seinem Vater, bis dieser stirbt, und die Leserinnen und Leser an eine Stelle geraten, an der sie schon mal waren. Knausgårds Ehe ist am Ende, er nimmt den Nachtzug nach Oslo; es soll alles anders werden. Wir wissen: bald wird er seine neue Frau kennenlernen, nicht mehr lang, bis er sich noch einmal so sehr verliebt, dass ein erster Kuss direkt in die Ohnmacht führt: es geht weiter. Um an diesen Punkt zu kommen, brauchen wir mit Knausgård lange, über 2000 Seiten – aber was sind schon ein paar Monate, Jahre, was sind schon ein paar hundert Seiten, wenn es darum geht, Hoffnung zu haben. (mehr …) -
März 17, 2015 - 1 Kommentar
Die Synthetische Biologie hat manche Probleme, das gravierendste ist, dass kaum jemand weiß, was das eigentlich sein soll. Das gilt beispielsweise auch für den transzendentalen Idealismus. Der Unterschied ist allerdings, dass man im Fall des transzendentalen Idealismus etwa 200 Jahre Zeit hatte, sich an das allgemeine Unverständnis und Desinteresse zu gewöhnen. Außerdem ist unwahrscheinlich, dass die Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften dem Institut für Demoskopie Allensbach den Auftrag erteilt zu messen, wie groß genau Unverständnis und Desinteresse in der Bevölkerung ausfallen.
Im Fall der Synthetischen Biologie, die "biologische Systeme wesentlich verändert und gegebenenfalls mit chemisch synthetisierten Komponenten zu neuen Einheiten kombiniert", ist genau das passiert. Es stellte sich heraus, das 87 Prozent der 2356 Befragten "Synthetische Biologie" mit "Eingriffen in die Natur" verbinden, und 82 Prozent bei dem Begriff an "Risiko, Gefahr" dachten – schlechtere Zustimmungswerte hat nur die Gentechnologie. Wenn man den Befragten erklärte, dass es sich bei dem Forschungsgebiet um eines handele, das dazu in der Lage sei, nachhaltige Treibstoffe zu erzeugen oder beispielsweise in der Krebsforschung zur Herstellung neuer Medikamente dienen könnte, stieg die positive Einstellung enorm. Auftritt der Schering Stiftung, hervorgegangen aus der Schering AG, die in der Bayer Pharma AG aufgegangen ist. Kerngeschäft von Bayer Pharma ist es unter anderem, im Bereich der Onkologie zu forschen und neue Medikamente für die Therapie zu entwickeln. (mehr …) -
Januar 26, 2015 - 6 Kommentare
Agathe Novak-Lechevalier ist maître de conférences (in etwa: Assistenzprofessorin) an der Université Paris X Nanterre. Sie ist Chefredakteurin des Magasin du XIXe sciècle, ihre Interessen umfassen dabei Roman und Spektakel, außerdem beforscht sie Stendhal und Balzac. Aus diesem sauber kuratierten Portfolio fallen ihre Arbeiten zu Michel Houellebecq etwas heraus.
Dieser Forscherpersönlichkeit dankt der Autor am Ende seines neuesten Romans Unterwerfung, der im Jahr 2022 spielt und von den Problemen eines abgehalfterten Literaturwissenschaftlers in einem Frankreich unter islamischer Regierung handelt. Direkt am Erscheinungstag wurde Unterwerfung (deutsch für: Islam) auf eine Art notorisch, die zu wiederholen hier überflüssig ist. Von dem Terror-Anschlag auf Charlie Hebdo ist Houellebecq nicht nur persönlich hart getroffen worden, sondern er durchkreuzt auch das Anliegen seines Romans. Worin dieses besteht, wird in dem kurzen Paratext auf der letzten Seite deutlich. Hier liegt gewissermaßen das punctum des ganzen Buches, die Danksagung legt offen, was die Bedingung der Möglichkeit dieses Romans ist: nämlich dass das, was er beschreibt, eine unrealisierte Fiktion bleibt. Damit ist viel weniger eine wie auch immer geartete Islamisierung gemeint, sondern ein ästhetisches Programm. Davon sprechen wir hier.
In Unterwerfung werden Frauen aus dem akademischen Leben herausgeschrieben. Mit Agathe Novak-Lechevalier wird aber nun eine Frau angeblich als einzige Quelle für alle Informationen zuständig, die Houellebecq für seine Schilderung des akademischen Lebens braucht. Es ist nicht so wichtig, ob das stimmt oder nicht: Deutlich wird, dass hier von einer Literatur die Rede ist, die allein auf Hörensagen beruhen darf, die sich aus abgefrühstückten Ideen und Phrasen zusammensetzen darf, wenn sie nur einen bestimmten Zweck erfüllt. Und der besteht hier primär in der Besetzung einer literaturhistorischen Position und nur sekundär in Houellebecqs lange bekannter Opposition gegen den Islam. (mehr …)